Home › Foren › Maximum Metal › Plattenladen › Top 50 Alben › Re: Top 50 Alben
26. Katatonia – The Great Cold Distance

Mit ihrem Zweitwerk von 1996 haben Katatonia es sich vergleichsweise leicht gemacht: „Brave Murder Day“ lebte von seiner gewissermaßen typisch jugendlichen emotionalen Unmittelbarkeit, von seiner höchst effektiven Simplizität. Imperfektion war damals nicht nur unmöglich zu vermeiden, sondern sogar vonnöten. Es ist erstaunlich, wie weit sich Katatonia von diesem Ideal mit „The Great Cold Distance“ entfernt haben. Der karge Midtempo-Deathdoom (sic!) wich einem recht kopflastigen, modernen, sehr eigenständigen Sound im weiten Spannungsfeld von Alternative Rock und Dark Metal. Zugegeben, zwischen den Alben liegen zehn Jahre, Jahre der Experimente und der Selbstfindung, und doch ist es bei näherer Betrachtung faszinierend, dass Katatonia an ihren Klassiker herankommen, ihn eigentlich sogar übertreffen konnten, mit einem Album, das mit BMD wenig bis gar nichts gemeinsam hat.
Mit „Viva Emptiness“ entdeckten Katatonia komplexere Arrangements und Songmuster, erst mit TGCD den zur Ausführung und Einbindung dieser nötigen Perfektionismus. Jedes Break und jedes Riff ist perfekt auf einander abgestimmt, jedes Detail, das man sonst, um das Flair und die Spontanität des ersten Takes zu wahren, im Songgebilde untergehen ließ, wurde nun mit fast krankhafter Präzision ausgearbeitet. Im glasklaren Sound hört man selbst noch das tiefste Basswummern. Zwar entfernte man sich auch auf „The Great Cold Distance“ nicht wesentlich mehr als auf „Viva Emptiness“ von einem konventionellen Songaufbau, doch innerhalb dessen erreicht die Verspieltheit des Drummings fast schon Tool’sche Ausmaße. Nun soll das aber nicht heißen, „The Great Cold Distance“ ließe die Emotionalität und Atmosphäre früherer Alben missen – ganz im Gegenteil. Während die Vorgängerwerke von geradezu zufälligen Treffern dieser Art lebten, zielen Katatonia nun mit bemerkenswerter, fast mathematischer Konzentration und Präzision auf den wunden Punkt des Hörers. Die Band operiert hier mit einem über die Jahre geschliffenen, infolgedessen aber auch äußerst scharfen Seziermesser. Man muss auch ob dieser sehr berechnenden Herangehensweise nicht unbedingt auf die obligatorischen Seelenwärmer-Melodien verzichten: die Singleauskopplung „My Twin“ schmiegt sich sofort an die Gehörgänge. Das erschöpft taumelnde „Journey Through Pressure“ fängt einen wunderbar sanft wieder auf und ist ein perfekt gesetzter Schlusstrack. „In The White“ hat einen schlichtweg brillanten Refrain, der selbst Kuschelkatatonia auf „Last Fair Deal Gone Down“ in der Form nicht gelungen ist.
Doch sind es nicht diese Momente, die „The Great Cold Distance“ ausmachen, es ist eher die kalte, entmenschlichte Atmosphäre, unter der sich „Deliberation“ nicht frei entfalten kann und die „Follower“ zum Ideal erklärt, es ist eher die erstaunliche, doch diesmal fast mechanische Härte, mit der „Consternation“, „Increase“ und „The Itch“ vorgehen. Es sind nicht die wärmenden, tröstenden Momente, oder zumindest nicht ganz unterdrückte Ausbrüche von Verzweiflung, von denen das Album lebt, sondern die monochrome Trostlosigkeit, das inszenierte Dystopia aus fremden, ausdruckslosen Gesichtern und Beton, die große kalte zwischenmenschliche Distanz, an der nicht zuletzt auch das sehr gelungene Artwork und die sowohl abstrakten als auch klar formulierten Lyrics von Jonas Renkse einen großen Anteil tragen. Man überwindet vielleicht die abweisende Distanziertheit von „The Great Cold Distance“, man dringt an sein zerbrechliches, flehendes, hilfloses Inneres und stößt schlussendlich auf einen resignierten, erkalteten, leblosen Kern. Letztendlich hat man der unüberbrückbaren Unnahbarkeit und Apathie der modernen Welt nichts entgegenzusetzen. Kaum eine Band hat diese Stimmung so gut vermittelt wie Katatonia auf „The Great Cold Distance“.
http://www.youtube.com/watch?v=6ow7rqkY-jI (tolles Video auch, das die auf dem Album vermittelte Atmosphäre visuell sehr gut einfängt)
http://www.youtube.com/watch?v=sCYPUgb370I
http://www.youtube.com/watch?v=qNPKRYovvi8
25. The Gathering – How To Measure a Planet?

Nach der streckenweise nicht ganz ausgereiften Genre-Blaupause „Mandylion“ veröffentlichten die Holländer 1997 mit ihrem vierten Album „Nighttime Birds“ auch gleich die klanggewordene Vervollkommnung des Gothic Metal, einen ausgefeilt und durchdacht arrangierten, elegisch-schönen, Prog Rock-beeinflussten Traum von einem Album. Doch war diesem Sound noch irgendetwas hinzuzufügen? Konnte man „Nighttime Birds Pt. II“ aufnehmen, nachdem man sich als eine der wichtigsten und vor allem wegweisendsten Bands des sich auf seinem Höhepunkt befindenden Genres erwiesen hat?
The Gathering haben offenbar beide Fragen verneint und sich ein Jahr später mit „How To Measure a Planet?“ vom mitdefinierten Stil entfernt. Die leicht progressiven Ansätze des Vorgängers wurden weiter ausgebaut, die Gitarren in den Hintergrund gedrängt, der hohe Ambient- und Trip Hop-Einfluss ließ auf ein reges Interesse an Brian Eno, späten Slowdive und Massive Attack schließen. Ihren Höhepunkt findet die Experimentierfreude im fast halbstündigen Titelstück, das sich nach und nach von seiner Struktur löst und zum Schluss klingt wie eine Mischung aus Eno-eskem Traumambient und der sich um Millimeter verschiebenden Repetitivität von Steve Reichs „Come Out“. Ein auf dem ersten Blick drastischer Kurswechsel, mit dem The Gathering Fans von „Nighttime Birds“ und insbesondere „Mandylion“ auf den Schlips getreten waren – dabei hat bei näherer Betrachtung gar kein wirklicher Stilbruch stattgefunden. Die getragenen, schwelgerisch-schönen Melodien, der herzerwärmende Gesang von Anneke van Giersbergen, sie sind immer noch da und stehen nun sogar noch weiter im Vordergrund, bloß in einem neuen Gewand. Der Frage, ob man den Stil von The Gathering nun als Gothic Metal oder „Trip Rock“ bezeichnen sollte, muss man insofern keine allzu große Bedeutung beimessen.
Die elektronischen Soundscapes geben dem Klang des Albums etwas eigentümlich Elektrisches, eine Art künstliche Wärme. „How To Measure a Planet?“ klingt über weite Strecken (mit Ausnahme der wunderschönen halbakustischen Ballade „My Electricity“) fremdartig und futuristisch. Der Grund, warum man sich in der hier aufgebauten Welt nie verloren, sondern immer absolut wohl und geborgen fühlt, ist der kraft- und gefühlvolle, glockenhelle Gesang von Anneke van Giersbergen. In keine Sängerin aus dem Metal-Umfeld war ich jemals so rettungslos verschossen wie in sie. Mit ihrer Stimme fängt sie auf und spendet Trost und Wärme, setzt der Konfusion ein Ende und macht viele der eher schlicht arrangierten, auf ihren Gesang abgestimmten Songs erst zu richtigen Perlen. Über weite Strecken fließen die Stücke leicht melancholisch und wunderbar entspannt, doch The Gathering wissen auch mit Dynamik und Kontrapunkten umzugehen, ohne dass es der Atmosphäre einen Abbruch tut. „Liberty Bell“ beispielsweise ist eine wunderbar erdlosgelöste, kraftvolle, mitreißende Spacepop-Nummer, „Illuminating“ versprüht im Refrain eine ansteckende Euphorie, „Probably Built In The Fifties“ klingt dynamischer und energischer als alles, was diese Band in ihrer Metal-Phase geschrieben hat und die Streicher von „Red Is A Slow Colour“ und die Gitarren und Effekte von „Rescue Me“ entwickeln irgendwann ein Eigenleben. Diese Songs sind es auch, die einzeln am besten funktionieren, doch entfalten die Stücke von „How To Measure a Planet“ ihre Wirkung, ihre ganz besondere Magie erst im Albumzusammenhang gehört, als ein Werk von beeindruckender in-sich-Geschlossenheit und Homogenität. Das eigentliche Herzstück des Albums, der Song, der mich immer noch am meisten berührt und vielleicht sogar mein absoluter Lieblingssong der Band, ist indes „Travel“: getragen von Streichern und schwebenden Gitarren nimmt er den Hörer mit auf eine wunderschöne Traumreise. Einer der größten Augenblicke des Stücks und des Albums ist der Gesangseinsatz und diese unheimlich weit ausholende Gänsehaut-Melodie gegen Ende, die schlichtweg nicht von dieser Welt sein kann: I wish you knew your music was to stay forever and I hope… Die unendliche Weite des Himmels in kompakten neun Minuten.
Nach HTMAP? stellte sich eine andere Frage: was machen The Gathering, nun, da ihnen alle Türen offen standen? Nach elf Jahren, fünf weiteren Studioalben auf durchgehend (sehr) hohem Niveau (bis einschl. „Home“) und einem aus meiner Sicht nicht unbedingt vorteilhaften Wechsel am Mikro (obgleich ihr Projekt Aqua de Annique über weite Strecken erschreckend fad daherkommt, stieg und fiel die Qualität der Stücke meist mit Annekes Präsenz und Charisma, da braucht man sich nichts vorzumachen) bleibt als Fazit zu sagen: nichts wirklich Besonderes. Zwar konnte man seinen Sound besonders auf „Souvenirs“ um einige feine Nuancen erweitern, ihm aber nichts wirklich Entscheidendes hinzufügen.
http://www.youtube.com/watch?v=Dcm6xRORFU8
http://www.youtube.com/watch?v=oNYg2iTEhmA
http://www.youtube.com/watch?v=WMv8GXhxjCU
24. Elend – Les Ténèbres Du Dehors
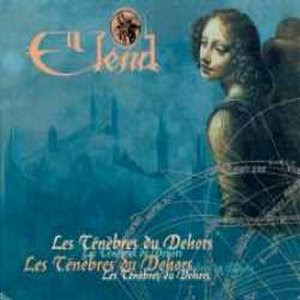
Lost in a dream…
Drowning in the eyes
Of a statue who dreamt a little dream of me…
Flächige Keyboardklänge. Zarter Soprangesang.
But here there is no light.
Dieser Satz ist, wenn man so will, der eigentliche, unheilsverkündende Anfang von „Les Ténèbres Du Dehors“, dem 1996 erschienenen Zweitwerk der französisch-österreichischen Neoklassik-Formation Elend. Es ist der zweite Teil der „Officium Tenebrarum“-Trilogie, einem Konzeptwerk um John Miltons „Paradise Lost“, die Rebellion und den Fall des ehemaligen Erzengels Luzifer (im wunderschön aufgemachten Booklet sind passend dazu Stiche von Gustave Doré und das Thema aufarbeitende Lyrics in Englisch, Französisch, Griechisch und Hebräisch abgebildet). Die relativ zurückgenommene, geradezu minimalistische Vorgehensweise, die den Vorgänger „Leçons de Ténèbres“ noch bestimmt hat, legte man ad acta, die Kompositionen haben deutlich an Länge und Komplexität, vor allem aber Bombast zugenommen. Die kunstvoll aufgebauten Symphonien wogen und erstürmen himmlische Höhen, nur um dann wieder in sich zusammenzufallen und den Hörer in eine bodenlose Schlucht zu stürzen. Engelhafte Sopranstimmen umspielen hochfliegende Streicherwinde und filigrane, betörende, von Chorälen getragene Melodien stützen sich auf sakrale Keyboardtürme. Wirkte er auf dem Debüt noch recht verloren, so fügt sich der Schreigesang Renaud Tschirners in dieser Klangkulisse wunderbar ins Bild ein und verleiht dem Sound von Elend seine Tiefe, Verzweiflung und Abgründigkeit. Dieser ist auch der Grund, warum Elend in bestimmten Teilen der Metalszene einen guten Ruf genießen – auf ein solches Instrumentarium griff das Kollektiv nie zurück. Eher berief man sich auf die klassische Musik des frühen zwanzigsten Jahrhunderts, aber auch auf große Komponisten wie Bach, Chopin und Vivaldi. Zeitweise klingen Elend wie Dead Can Dance mit einer pechschwarzen Seele.
Elend erschaffen auf „Les Ténèbres Du Dehors“ eine Klangkathedrale von einschüchternder, aber auch höchst ästhetischer und beeindruckender Architektur. Als mustergültiges Beispiel für die Effektivität, Atmosphäre und Tragweite von „Les Ténèbres Du Dehors“ dient „The Luciferian Revolution“: der Zusammenbruch und der Taumel am Ende jagen mir jedes Mal wieder eine Gänsehaut über den Rücken. Einzig den manchmal etwas künstlichen Klang der Streicher und der Keyboards könnte man bemängeln, doch gemessen daran, dass Elend hier zwar ein echter 12-Personen-Chor, nicht jedoch ein echtes Orchester zur Verfügung stand, ist das Ergebnis beeindruckend wohlklingend.
Ein Meisterwerk – zwei Jahre später sollten Elend es jedoch sogar noch übertreffen.
http://www.youtube.com/watch?v=VI4LYpgXm9Y
http://www.youtube.com/watch?v=SfuGHE_8tNE
http://www.youtube.com/watch?v=T3DJKDsNL0k
http://www.youtube.com/watch?v=X742hwYnujM
23. Elend – The Umbersun

A shadow of horror is risen.
Dieser Textauszug steht sinnbildlich für die Stimmung von „The Umbersun“, des letzten Teils der „Officium Tenebrarum“-Trilogie von Elend. War schon sein direkter Vorgänger „Les Ténèbres Du Dehors“ geprägt von äußerster Finsternis und Tristesse, so setzt „The Umbersun“ noch einen drauf – in jederlei Hinsicht. Der Sound ist (noch) dichter und voluminöser, vom etwas künstlichen Klang der Keyboards und der Streicher ist nichts übrig geblieben. Ebenfalls (fast) nichts übrig geblieben ist von der Ästhetik, Schönheit und Eleganz, die „Les Ténèbres Du Dehors“ noch ausmachte, nichts auf diesem Werk, nicht eine einzige Note könnte so bezeichnet werden. Es gibt sie zwar, die Momente, in denen die Melodie kurz Überhand gewinnt und in denen das flammende Inferno sich kurz legt, doch sind sie in diesem Kontext von keiner großen Bedeutung, höchstens unheilverkündend, der Umgang mit ihnen reine Formalität. Zu Tausenden, von allen Seiten und in höllischen, ohrenbetäubenden Kaskaden aus Dissonanz prasseln die Klänge auf den Hörer ein; schon allein um diesen Sinneseindruck vollstens auf sich wirken lassen zu können, sind Kopfhörer oberste Pflicht. Die Streicher wirbeln in schwindelerregender Geschwindigkeit umeinander. Chöre duellieren sich, die Stimmen erklimmen Höhen, dass einem die Luftzufuhr abgeschnitten wird. Das hier hat nun nichts mehr von der früheren sakralen Schönheit, dies ist ihr sinisteres, unheiliges Gegenteil. Der Sound hat eine Dichte, in der es keine Klanglöcher und Verschnaufpausen gibt, und ist gleichzeitig von bemerkenswerter, erbarmungsloser Transparenz. Manchmal bahnt sich eine schrille, schier durchdringend hohe, gepeinigte Geige ihren Weg. Man versucht vergebens, sich bei diesen Symphonies of Destruction an einer klar erkennbaren Struktur festzuhalten – „The Umbersun“ ist ein stundenlanger Fall ins Licht- und Bodenlose. Ein Paradebeispiel für diese höchst einnehmende Atmosphäre ist das ausgesprochen treffend betitelte „Apocalypse“; der Einsatz der rituellen Trommeln ist der Spannungshöhepunkt von „The Umbersun“.
„The Umbersun“ steht dem Frühwerk von Diamanda Galas somit deutlich näher als Black Tape For A Blue Girl oder Dead Can Dance. Vor allem aber lässt es in seiner Wirkung alle (mir bekannten) Alben aus dem Black-/Death-/Schlagmichtot-Umfeld weit hinter sich.
Nach dem Ende der „Officium Tenebrarum“-Trilogie sollten Elend sich zumindest vorläufig auflösen. 2003, fünf Jahre nach Veröffentlichung von „The Umbersun“, begannen sie eine neue Trilogie, den „Winds Cycle“, bei dem die Kompositionen kompakter und weniger symphonisch wurden und man mit Industrial- und Dark Ambient-Sounds experimentierte. Nach „A World in Their Screams“ löste man Elend erneut auf, diesmal aus finanziellen Gründen (das Arrangieren und Aufnehmen der Stücke war zu umfangreich und somit nicht mehr tragbar) – der „Winds Cycle“ war ursprünglich als Fünfteiler geplant.
http://www.youtube.com/watch?v=_idNE-oZBZA
http://www.youtube.com/watch?v=1nLpNlXV7Wo
http://www.youtube.com/watch?v=QJSAx032wBs
22. Einstürzende Neubauten – 1/2 Mensch

Halber Mensch
Halber Mensch
Halber Mensch…
Ein benommener Frauenchor, wie hypnotisiert und Seele und Hirn beraubt.
GEH WEITER!!!
IN JEDE RICHTUNG!!!
WIR HABEN WAHRHEITEN FÜR DICH AUFGESTELLT!!!
Das Titelstück des dritten Albums von Einstürzende Neubauten fängt an. Ein Chor gleichgeschalteter Seelenloser und Blixa Bargelds von jeder Ecke des Raumes zurückgeworfene Stimme.
Sieh deine 2. Hälfte
Die scheinbar grundlos schreiend erwacht
Schreiend näherkommt
Du siehst sie nicht
Bist gefesselt vom Abendprogramm
Ein Bild, das durch den realen Bezug noch mehr Beklemmnis und Verstörtheit auslöst.
Du formlose Knete
Aus der die Lebensgeister den letzten Rest Funken aussaugen
Fliegen taumelnd, besoffen davon
Tanzen nutzlos in der Sonne
Bargeld würgt diese Zeiten unglaublich verächtlich und angewidert aus sich heraus.
Einstürzende Neubauten waren bei ihrer Gründung noch so etwas wie ein sehr merkwürdiger Aprilscherz. Ein Aprilscherz, bei dem einem das Lachen im Halse stecken blieb. Inmitten der Post-Punk-Bewegung und des in ihrem Schoß aufblühenden Industrial-Genres wurde „Kollaps“ veröffentlicht, ein lärmiges, gnadenlos rhythmisches Konstrukt, das sich grundlegend von allem unterschied, was damals unter „Post-Punk“ und ähnlichen Begriffen zusammengefasst wurde und gerade deshalb, wegen dieser grenzüberschreitenden Ästhetik, doch ein wichtiger Bestandteil und Meilenstein dieser Bewegung wurde. Titel wie „Schmerzen hören“ und „Hirnsäge“ sprachen eine klare Sprache. Schon mit dem Nachfolger „Zeichnungen des Patienten O.T.“ verabschiedete man sich von dieser direkten, überverzerrten Vorgehensweise – harmonischer oder verdaulicher ist man indes keineswegs geworden. Die Interessierten und Faszinierten, die sich „D.N.S. Wasserturm“ angehört hatten, wendeten sich entweder verständnislos oder angewidert ab oder aber sie waren für ihr Leben versaut. Beide Werke waren offensiv, provokant, grausam, artifiziell und radikal. So vertrauenserweckend wie ein Flugzeug aus verseuchtem Industriemüll und so schön wie ein Autounfall.
Lass uns noch etwas Wodka holen, russische Vitamine…Drumbeat aus der Hölle, wie er stumpfer, nervenzerfetzender und zwingender …dübelt sich in meinen Kopf… nicht eingefallen wäre. Wovon reden wir denn die ganze Zeit? Zieh! Pssst! Die Effekte könnten in einem früheren Leben Streicher gewesen sein…NUMB YOUR IDEALS!!! Jetzt Messerwetzen. Irgendwo Geklimper auf Küchenbesteck. Ich bin 12 Meter groß und alles ist unvorstellbar!!! Keyboard wird malträtiert, die Wände kommen näher. Yü-Gung kann Berge versetzen.
Auch auf das dritte, 1985 veröffentlichte Album der Neubauten traf dies zu. Aber sie schrieben nun tatsächlich Songs. Songs, wie sie in der damaligen Neubauten-Welt halt so aussahen, aber den Satz konnte man jetzt sagen, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen – auch wenn man sich bei der Aussprache doch noch einige Male verschluckte. Wem würde man es übelnehmen, wenn er im Taxi zu heulen anfangen würde, während das gequälte, zwischen völliger Stille und ohrenbetäubendem Lärm pendelnde „Seele brennt“ läuft? Was für ein komplett verkorkstes Körpergefühl muss man haben, um den Z.N.S. zu tanzen? Und doch; allen Songs obliegt eine (nicht unbedingt herkömmliche) Struktur, „Yü-Gung (fütter mein Ego)“ sogar ein richtig tanzbarer Rhythmus und „Letztes Biest (am Himmel)“ eine melancholische Melodie. Sie sind nicht wirklich weniger drastisch oder weniger verstörend geworden, aber auf jeden Fall weniger destruktiv. Schon hier zeichnet sich das spätere Seilziehen von Harmonie & Struktur und Noise ab, auch wenn noch nicht vorstellbar war, wer es später gewinnen würde. Bis dahin aber:
Sag auf Wiedersehn zum Nervensystem.
http://www.youtube.com/watch?v=y0LF6WA9rxI
http://www.youtube.com/watch?v=NuBYmqK2w48
http://www.youtube.com/watch?v=Ou6kN-XUh_U
--
trying to leave [COLOR=#808080]a mark more permanent than myself[/COLOR]