Home › Foren › Maximum Metal › Plattenladen › Top 50 Alben
-
AutorBeiträge
-
Würde mich auf jeden Fall interessieren! Dank dir bin ich auf die Deftones gekommen 🙂
Vielleicht verbirgt sich noch so eine Perle in deiner Liste!Highlights von metal-hammer.de'[A.F.P.;1630398′]Ich würde hier durchaus recht gerne meine Top 20 vorstellen, falls Interesse besteht. Ich mein ich hab in diesem Thread schon ein paar Alben vorgestellt und das hat kein Schwein intressiert. Also falls Interesse besteht mach ich es, aber falls es nur wieder ignoriert wird…. naja ich hab besseres mit meiner Zeit anzufangen.
Ich für meinen Teil hab’s gelesen. 😉
Go!5x Damenriege (gut, bei Slowdive gibt es zugegebenermaßen größtenteils, aber eben nicht ausschließlich, männlichen Gesang), ein Wiedersehen mit Madame Harvey und ein Album, das irgendwie komplett aus dem Rahmen fällt…die Plätze 36-32:
36. PJ Harvey – White Chalk

Immer war sie in gewisser Weise die Unnahbare, immer merkte man ihr die Distanz zu den auf den Alben erzählten Geschichten und aufgebauten Charakteren an. Auf „White Chalk“, ihrem 2007 erschienenen letzten regulären Studioalbum, ist dies nicht der Fall. Und das ist es, was „White Chalk“ selbst in einer solch abwechslungsreichen Diskographie wie der von PJ Harvey noch einen Sonderstatus verleiht: nicht bloß die ungewöhnliche Instrumentierung und ebensolcher Gesang, sondern eine grundsätzlich andere Atmosphäre. War sie auf allen anderen Alben noch eine wirklich begnadete Schauspielerin, die sich gewiss auch mit ihrer Rolle identifizierte, die Stimme anderer, so wirkt ihre seelische Entblößung auf „White Chalk“ beklemmend real. Trug sie auf den Vorgängerwerken selbst noch den größten Schicksalsschlag mit Fassung, zeigte sie selbst dann noch unberührbare Stärke, wenn sie am Boden lag, schien ihr Make-Up selbst dann nicht zu verlaufen, wenn sie bittere Tränen weinte, so offenbart sie auf „White Chalk“ tatsächlich Fragilität, Schwäche und Erschöpfung.
Polly Jean Harvey greift dabei auf spartanische, schlichte Instrumentierung zurück, die meisten Songs basieren auf simplen Klaviermotiven (sie hatte sich das Klavierspielen binnen kurzer Zeit selbst beigebracht, Virtuosität war weder zu erwarten, noch wirklich vonnöten). Die eigentliche Kraft ihrer Stimme offenbart sie nur kurz und andeutungsweise im bitteren „Grow Grow Grow“, ihr Gesang klingt erschöpft und geradezu kindlich hoch, meist singt sie mit Kopfstimme. Die Songs umgibt eine gewisse Intimität, es ist, als ob PJ Harvey sie in einem sehr kleinen, von einer Kerze nur schwach beleuchteten Raum ganz für sich alleine spielt. Sie spielt sie mit dem Bewusstsein, ihr Requiem zu spielen, außer Kraft, doch willens, sich noch etwas Wichtiges von der Seele zu singen. „White Chalk“ klingt wie am Totenbett aufgenommen. Farewell my friends, farewell my dear ones, farewell this world, forgive my weakness. Mit Wehmut und Reue blickt sie auf ihr bisheriges Leben zurück, haucht Entschuldigungen, die die, an die diese gerichtet sind, nicht mehr hören werden. Über den Songs liegt ein grauer Schleier. Man hat das Gefühl, den dumpfen, langsamer werdenden Herzschlägen der Songs zu horchen, in dem Bewusstsein, dass diese jeden Moment gänzlich verschwinden würden. Stützen sich die Stücke zu Beginn noch auf eine rhythmische Struktur, verlaufen die Konturen von „To Talk To You“ fast völlig, scheint Harvey kaum die Kraft aufbringen zu können, das unendlich traurige „Before Departure“ zu Ende zu bringen, wird „Broken Harp“ bereits nach weniger als zwei Minuten die Luft abgewürgt. Der schönste und berührendste Song des Albums ist indes „Silence“:
I freed myself from my family
I freed myself from work
I freed myself
I freed myself
And remained aloneEin Song fürs Totenbett.
Ein Song, um das Leben am inneren Auge vorbeiziehen zu lassen.
Ein Song, um sich und der Welt zu verzeihen.
Freiheit und Leere.Inmitten vieler mindestens guter, einiger absolut großartiger Alben, in denen sie sich stetig weiterentwickelte, ihren Geschichten eine beeindruckende stimmliche Präsenz verlieh und als Persönlichkeit stets undurchsichtig blieb, wirkt „White Chalk“ gewiss am authentischsten. Klar ihr bestes Album nach der Jahrtausendwende.
http://www.youtube.com/watch?v=9_3pBlHUEjM
http://www.youtube.com/watch?v=uphcFYUE0Dc
http://www.youtube.com/watch?v=alm5Wr_qYpA35. Tori Amos – Little Earthquakes

Was ist bei einem ambitionierten, sich stetig weiterentwickelndem Künstler schlimmer, als wenn er sein Magnum Opus schon mit dem Debüt veröffentlicht? Nun ist es aber nicht so, dass man die Nachfolgewerke von „Little Earthquakes“ ignorieren sollte, insbesondere sein wesentlich weniger klavierbasierter direkter Nachfolger „Under the Pink“ und das Coveralbum „Strange Little Girls“ sind wirklich sehr gut/interessant geworden. Doch gelang es Tori Amos auf den späteren Alben selten, die radiokompatibleren Popsongs so auf den Punkt zu bringen und sie gleichzeitig niemals banal wirken zu lassen wie hier. Da wären zum Beispiel gleich der Opener „Crucify“, ihr neben „Cornflake Girl“ wohl bekanntester Song, das ironische „Happy Phantom“ sowie sowohl die ganz große als auch die ganz dezente Ballade: „Winter“ hat eine wunderschön epische, weit ausholende Melodie, doch Amos lässt das Stück nie den Boden unter den Füßen verlieren und in kitschige Gefilde abdriften. „Tear In Your Hand“ gibt sich trotz seiner Wehmut ganz leichtfüßig, übergibt einem seine Botschaft quasi im Vorbeigehen.
Und doch sind es nicht diese Songs, die für mich „Little Earthquakes“ ausmachen, es sind die weitaus sperrigeren, unangenehmeren Titel. Wenn Amos in „Silent All These Years“ eine Fehlgeburt, in „Me And A Gun“ eine Vergewaltigung und in „Mother“ die schwierige Beziehung zu ihrer Mutter aufarbeitet, dann löst es Bestürzung und Unbehagen aus, man will es eigentlich nicht mehr hören, man hat das Bedürfnis, den Raum zu verlassen und seine Gedanken auf etwas anderes zu lenken ob so viel schmerzenden autobiografischen Bezugs. Doch Amos versieht selbst die offensichtlich autobiografischen Texte immer auch mit Doppelbödigkeit und einer Vielzahl an Interpretationsmöglichkeiten. So schaffte es die junge Tori Amos, deren Gesangsstil damals noch nicht ganz zu Unrecht mit Kate Bush verglichen wurde, auch meinen Gedanken und Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Der Titeltrack wirkt schwer und aufwühlend, doch absolut reinigend. „Precious Things“, nachwievor mein absoluter Lieblingssong von ihr, ist voller Verzweiflung und Wut; der Verzweiflung und Wut einer enttäuschten und gedemütigten jungen Frau, einer wahnsinnig authentischen, mit Agonie besungenen und auf dem Klavier gehämmerten Wut, die die tumben, testosteronschwangeren, gitarrengetriebenen Kraftakte männlicher Musiker-Kollegen lächerlicher wirken lässt, als sie eh schon sind.
Es ist gewiss nicht das musikalisch reifste Album der Dame, genauer betrachtet ist es ein ziemlich typisches Debüt, auf dem so manch Idee noch nicht ausformuliert werden konnte. Und obgleich ich vor dem Hintergrund verstehen kann, wenn jemand spätere Alben bevorzugt, so besitzt „Little Earthquakes“ doch etwas Wichtiges, nicht näher Benennbares, was seine persönliche Bedeutung für mich doch höher macht als die der anderen Alben.
http://www.youtube.com/watch?v=HLL6ON18vGI
http://www.youtube.com/watch?v=KWmETxWM0h0
http://www.youtube.com/watch?v=t4s1flZ3JKI34. Slowdive – Souvlaki

Beim Überfliegen meiner Liste ist mir aufgefallen, dass sich immer eine gewisse Dunkelheit und Negativität, zumindest aber eine leichte Wehmut und Melancholie wie ein roter Faden durch meine Auswahl zieht. Mit Ausnahme von „Souvlaki“: kein anderes Album repräsentiert für mich das pure, ungetrübte, gelassene Glücksgefühl besser als Slowdives Zweitwerk. 1994 gehörte man neben Ride mit „Nowhere“ und natürlich My Bloody Valentine mit „Loveless“ zum großen Triumvirat der 90er Shoegaze-Welle; ein kurzlebiges, sehr zeitgebundenes Genre, dessen dämlicher Name darauf zurückgeht, dass Shoegaze-Soundexperimentalisten beim Gitarre spielen immerzu auf ihre Schuhe starren würden. Hauptmerkmale dieser Stilistik waren sehr zarte und hohe, meist verfremdete Stimmen und ein ganz besonderer, sowohl monolithischer und noisiger als auch luftiger und psychedelischer Gitarrensound. Auch Slowdive bedienten sich dieser Stilmittel, erhoben dies aber nicht zum Exzess wie My Bloody Valentine und hatten auch kein Stück der beißenden, polaren Kälte von Ride. In Songs wie den Opener „Alison“, das unglaublich überzuckerte „Machine Gun“ und das seinem Namen entsprechende „Souvlaki Space Station“ fällt man wie in halbwegs massive Wolken (ein ob der Luftigkeit kaum angebrachter Begriff) und wird von wohliger Helligkeit und Wärme umgeben. „When The Sun Hits“ (Das Cover von The Gathering ist übrigens wirklich empfehlenswert!) ist der gewiss strahlendste, sommerlichste Song, den ich kenne, löst selbst bei miserabelster Laune eine ruhige Euphorie in mir aus, lässt selbst beim am dichtesten bewölkten Himmel Sonnenstrahlen hindurchscheinen. Bei „Sing“ taucht man in eine kaum bewegte, idyllische Unterwasserwelt ein, die von entfernten Sonnenstrahlen erleuchtet wird. Nun gibt es auf „Souvlaki“ aber auch Nummern mit reduzierter Instrumentierung, die einen Rückschluss auf die Ausrichtung der quasi-Nachfolgeband Mojave 3 zulassen, wie „Here She Comes“ und den Schlusstrack „Dagger“. Und nun zieht sich auch dieser friedvollen, positiven Atmosphäre zum Trotz immer eine gewisse Melancholie und Sentimentalität durch die Musik und vor allem die Texte. Auch der purste, ungetrübteste Glückszustand zeichnet sich aus durch Vergänglichkeit. …And me I am her dagger, to numb to feel her pain. Und so gibt es auch wieder einen Bezug zu den restlichen Alben aus meiner Liste…ich bin ja so…berechenbar…^^
http://www.youtube.com/watch?v=G0LIO138Z-A
http://www.youtube.com/watch?v=8J2O6SAOmxw
http://www.youtube.com/watch?v=CczmMDvQDa033. Nico – The Marble Index
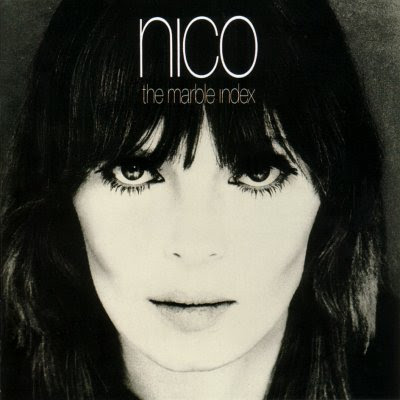
Die kühle, statuenhafte Schönheit wird den meisten von ihrer Mitarbeit am wegweisenden The Velvet Underground-Debüt und vielleicht noch durch „These Days“ von ihrem Solo-Debüt bekannt sein. Während „Chelsea Girl“ noch ein dezent melancholisches, relativ leicht verdauliches Werk von Künstlern wie Bob Dylan, Lou Reed und John Cale war, dem Nico lediglich ihre Stimme lieh, ein Album, von dem sie später behauptete, es zu hassen, da es ihre musikalische Vision nicht repräsentierte, wurde mit dem Nachfolger „The Marble Index“ alles anders – wer hier noch einen Song vom Format von „Femme Fatale“ oder eben „These Days“ erwartete, dem ließ TMI das Blut in den Adern gefrieren.
Die Zahl der Mitwirkenden verringerte sich auf Nico selbst und den ausgebildeten klassischen Musiker John Cale, vorher ebenfalls bei The Velvet Underground aktiv. Mit Viola, Piano, Cello, Violine und präparierten Gitarren (Nico selbst spielte noch Harmonium, eine Art Spinett-Klavier) bildet er das musikalische Gerüst der Stücke: eine Art avantgardistische, dissonante Kammermusik, bei der die Instrumente, fast ohne wirklich offensiv-lärmig zu klingen (den Gefallen tut man dem Hörer selten), ihrer Wärme und Lebendigkeit, ihres Schönklangs beraubt wurden. Nico singt ihre kryptisch-metaphernreichen, negativen Texte; ihr Vortrag gleicht eher einem melodischen Vortrag von Gedichten als herkömmlichem Gesang. Charakteristisch für ihren Gesangsstil sind eine stoische Emotionslosigkeit und Ernsthaftigkeit (zumindest noch auf „The Marble Index“), die gleichzeitig Nicos (bürgerlich Christa Päffgen) kalte, nihilistische Aura bilden, die Tiefe ihrer Stimme und ihr grober deutscher Akzent (sie war gebürtige Kölnerin). Nico gab dem Tod eine Stimme. Obwohl ihr Gesang dem Hörer nie den Gefallen einer greifbaren Emotion und Identifikationsfläche tut, bildet er oftmals die größte melodische Konstante in Kompositionen, die sich selbst teils in hypnotischen Wiederholungen, teils in nebeneinander gesponnenen Fast-Melodiebögen verlieren und oft nicht den geringsten Rückhalt bieten.
Seine Geschlossenheit und Intimität stellt „The Marble Index“ dabei über seine (zweifelsfrei tollen!) Nachfolgealben und erzeugt eine beispiellos einsame, leere und isolierte Atmosphäre. „No One Is There“, aufgrund seiner schönen Violinenmotive eines der verdaulichsten Stücke des Albums, wandelt zwischen den Säulen des inszenierten Eisschlosses, sein Nachhall geht unter in weiter, absoluter Leere. Die eisige, gnadenlose, unwirtliche Kälte zieht sich wie ein roter Faden durch das gesamte Album, kein Windhauch und kein Blätterrascheln gibt einen Hinweis auf Leben. Es gibt in dieser spröden, trostlosen, doch in ihrer Weite und Leere auch irgendwie malerisch schönen Eiswüste einzig diese sonderbare Musik und Nicos erzählende Stimme. Bei „Ari’s Song“ kann man kaum ein Gefühl der Bedrücktheit und Betroffenheit vermeiden, handelt es doch von ihrem damals schwer kranken unehelichen Sohn Alain. Mit folkloristisch anmutenden Gesangslinien erhebt sich „Frozen Warnings“ über das leblose Land, es könnte ein majestätischer Abschluss sein, der den Hörer mit so etwas wie einem Schimmer Hoffnung aus dem Album entlassen könnte, würde ihm nicht „Evening of Light“ folgen. Es ist einer der verstörendsten und beklemmendsten Songs, die ich jemals gehört habe, vielleicht DER verstörendste und beklemmendste überhaupt. Über ein nur vorahnendes, vielleicht anfangs noch harmloses Spinettklimpern legt sich Nicos charakteristischer Gesang. Midnight winds are landing at the end of time. Das atonale Klimpern wird lauter, im Hintergrund baut sich ein lautes, tiefes Brummen auf. Aus dem dicht bewölkten, von Blitzen und Explosionen erhellten Himmel fallen Splitterbomben auf die Umgebung, es ist ein grauenvolles Schreckensszenario, alles liegt irgendwann in Schutt. Einzig Nicos Gesang trotzt konstant und unbeirrt, starr, beinahe unbeteiligt dem sich um sie herum abspielenden Chaos. Mein musikalisches Weltbild wurde binnen 5:40 Minuten pulverisiert. Midnight winds are landing at the end of time.
„The Marble Index“ wurde ein kommerzieller Flop sondergleichen. Es bekam wohlwollende Kritiken, anno 1968 machte man aber lieber einen großen Bogen um diesen höchst sonderbaren Marmorbrocken. „The Marble Index“ stand in der Musiklandschaft allein auf einer weiten, leeren Fläche, die es sich selbst geschaffen hat. Es ist ein Album für bereits verlorene Seelen, gescheiterte Eskapisten, oder zumindest die, die in einer solchen Stimmung zumindest für eine gute halbe Stunde auf- und untergehen möchten.
Aufgrund ihrer unnahbaren, geheimnisumwobenen Aura und ihres exzessiven, selbstzerstörerischen Lebensstils wurde Nico zum frühen Sinnbild der damals nicht einmal ansatzweise existenten Gothic-Bewegung. Ende der 70er und Anfang der 80er beschrieb man Gothic Rock teilweise als Punk mit der eisig-anmutigen Atmosphäre von Nico-Alben, Genre-Ikonen wie Siouxsie Sioux (Siouxsie and the Banshees), Peter Murphy (Bauhaus) und Ian Astbury (Southern Death Cult/The Cult) berufen sich auf sie. Nico war Post-Punk, bevor es Punk gab. Und doch ist die mystische Aura von „The Marble Index“ vor allem ein Verdienst der Tatsache, dass sich kaum etwas daran geändert hat, dass es so allein und monolithisch auf einer weiten, leeren Fläche steht. Die, die sich auf dieses Werk eingelassen haben, hauchen seinen Namen mit Bewunderung und respektvollen Distanz. Es ist ein Album weit abseits von musikalischen Bewegungen und Zeitgeist. Und diese Aura wird es vermutlich für immer behalten.
1988 starb Nico im Alter von 50 Jahren auf Ibiza. R.I.P!http://www.myspace.com/thenicoparadox
32. Fear of God – Within the Veil

Dieses Album ist bestens geeignet für Leute, die Angela Gossow (Arch Enemy) und Candace Kusculain (Walls of Jericho) für das Maß aller Dinge, die einzig erwähnenswerten oder gar generell die einzigen Frontfrauen im extremen Metal halten, dieses Album ist perfekt für all jene, die mit den Stichworten „düsterer Metal mit weiblichem Gesang“ primär verkitschtes Trällerelsengesäusel verbinden, dieses Album ist wie geschaffen für die, die schrottigen Einmannprojekt-Heulsusen-Keller-Black Metal für das Nonplusultra depressiver Musik halten. Düsterer, sperriger Thrash Metal bildet das musikalische Fundament, eine Art Slayer-Riffing in einer gemäßigten, bedrückten und bedrückenden Version, auch doomige Ansätze sind vorhanden. Das klingt recht interessant und auch originell, ist aber nicht das, was das Album zu etwas Besonderem macht und ihm seinen (persönlichen) Klassikerstatus und seine einzigartige Atmosphäre verleiht, sondern die wahrlich beeindruckende Gesangsleistung von Dawn Crosby. Sie singt dabei selten wirklich clean und melodisch, am meisten noch in der endlos traurigen quasi-Ballade „Wasted Time“, eher schreit, flüstert, jammert, stöhnt und wimmert sie, um ihrem Schmerz Ausdruck zu verleihen. Und es ist schwer bis unmöglich, bei dieser höchst authentischen (man fühlt regelrecht, wie Dawn die Songs immer wieder durchlebt) Intonation der tiefschwarzen, absolut pessimistischen, erschütternden, erschreckend autobiografischen Texte keinen dicken Kloß im Hals zu haben. Es ist ein stockfinsterer, lichtabsorbierender, grausamer, allesverschlingender Moloch namens Realität, der in den Texten dargestellt wird und der durch das tragische Leben und Lebensende von Sängerin Dawn Crosby noch beklemmender wird; Ab ihrem dreizehnten Lebensjahr wuchs sie in einer Umgebung von Militär, Missbrauch, Prostitution und Alkoholismus auf. Um sich ihr Überleben zu sichern, prostituierte sich eine gute Freundin von ihr, wurde misshandelt und verletzt und ertränkte sich schließlich vor Dawns Augen. Gleich nach diesem Ereignis entstand laut Dawn der Text zu „Red To Grey“, die Musik indes erst mehr als zehn Jahre später. Auch im gespenstischen, nebligen „White Door“ bezieht sie sich auf dieses Trauma.
Ich kann mir das Album mittlerweile nur noch selten anhören, nebst der Musik und der Texte selbst und ihrer traurigen Vorgeschichte ist mir das Album nicht zuletzt aufgrund eines persönlichen Bezugs (in den Tiefpunkten meines Lebens war es ein treuer Begleiter…falls es irgendwen interessiert. *hust*) meist schlichtweg zu drastisch. Das ist etwas, was man der Band hoch anrechnen muss, das ist auch genau der Grund, warum ich das Album derart verehre. Die Stimmung gelangt an ihren Höhe- bzw. Tiefpunkt am Ende des Schlusstracks „Drift“: I want to feel something…REAL!!! Dawns Schreie sind absolut markerschütternd, knapp beschrieben sowas von Exodus.
Leider konnte die Band zu Zeiten ihrer Aktivität nie den Status erlangen, den sie eigentlich verdiente, dies lag neben der Sperrigkeit und Düsternis des Materials auch an der Unüblichkeit von weiblichem Gesang im extremen Metal und auch an der geringen Livepräsenz. Das nach dem Ausstieg von Gitarrist Michael Carlino veröffentlichte Zweitwerk „Toxic Voodoo“ konnte nicht die Erwartungen von Fans und Kritikern erfüllen und auch nicht diese ganz spezielle Magie vom Vorgänger vermitteln. Das 1991 erschienene „Within the Veil“ war lange Zeit ein gesuchtes, nur für hohe Preise zu erstehendes Sammlerstück (neulich habe ich es auf Amazon im gebrauchten Zustand allerdings zu einem vertretbaren Preis gesehen). Fünf Jahre nach der Veröffentlichung von „Within the Veil“ sollte Dawn ihrer durch Alkoholmissbrauch verursachten Lebererkrankung erliegen. Rest In Peace!
http://www.youtube.com/watch?v=nSYpzRsFd5I
http://www.youtube.com/watch?v=_uu2OJR8ej0
http://www.youtube.com/watch?v=8NFzSqvNPig--
trying to leave [COLOR=#808080]a mark more permanent than myself[/COLOR]Sehr interessante Liste bis jetzt, die auch sehr schön geschrieben ist. Von vielem habe ich vorher nie was gehört, da werde ich bei einigen Sachen sicher noch genauer reinhören. Und du hast mich daran erinnert, dass ich eindeutig mehr von PJ Harvey brauche!
--
Sorrow is knowledge: they who know the most Must mourn the deepest o’er the fatal truth, The Tree of Knowledge is not that of Life.PervitinSehr interessante Liste bis jetzt, die auch sehr schön geschrieben ist. Von vielem habe ich vorher nie was gehört, da werde ich bei einigen Sachen sicher noch genauer reinhören. Und du hast mich daran erinnert, dass ich eindeutig mehr von PJ Harvey brauche!
Brauchst du, definitiv. Braucht eh jeder. :8)
Und danke für die Blumen! 🙂Die Labertasche schlägt wieder zu:
31. This Mortal Coil – Filigree & Shadow

Mit dem 1986 erschienen Nachfolger von „It’ll End In Tears“ rückte das Projekt der 4AD-mehr-oder-minder-Prominenz (Elizabeth Fraser und Lisa Gerrard waren nicht mehr dabei, ein Umstand, den man ob des erstklassigen Gesangs jedoch verschmerzen konnte) ein Stück weit aus dem Fokus der Aufmerksamkeit; klar, hatte man hier doch auch nicht das ungeheure Glück, die namenlosen Komponisten einer Hintergrundbeschallung für Parfümwerbung zu sein *hust*. Doch es liegt gewiss auch daran, dass This Mortal Coil mit ihrem Zweitwerk deutlich unzugänglicher und experimenteller wurden. Die klassischen und weltmusikalischen Ansätze des Vorgängers wurden weiter ausgebaut und es kam ein starker Electronica-/Ambient-Einschlag hinzu, die klassisch strukturierten Songs drängte man in den Hintergrund. Songs wie „Tears“, das Nina Simone-Cover „My Father“, „I Want To Live“, das wunderschöne „Morning Glory“ und das leidenschaftliche, leicht rockig angehauchte „Strength of Strings“ mögen im Gegensatz zu den experimentellen Soundcollagen und klassischen Interludien auch einzeln Sinn ergeben, entfalten sich jedoch erst als Bestandteil der in 25 nahtlos ineinander übergehende Teile gegliederten Symphonie „Filigree & Shadow“. Obwohl man sein musikalisches Spektrum beträchtlich ausweitete (was sich auf dem sehr guten Nachfolger „Blood“ manchmal zu Lasten der Homogenität auswirkte), ist diesem Umstand eine bemerkenswerte in-sich-Geschlossenheit zu verdanken. „Filigree & Shadow“ wirkt außerdem besonders zum Ende hin deutlich dunkler und melancholischer als sein Vorgänger; was dort nicht wirklich zu Ende gedacht wurde, nimmt beim von Wire-Sänger Colin Newman arrangierten „Alone“, dem beklemmend pulsierenden Instrumental „The Horizon Bleeds And Sucks Its Thumb“ sowie dem neurotischen, Funk-lastigen Talking Heads-Cover „Drugs“ Überhand. Dadurch gewinnt „Filigree & Shadow“ gegenüber „It’ll End In Tears“ zusätzlich an Tiefe. Auch in Sachen Produktion hat man deutlich Fortschritte gemacht: dass das Album nunmehr über 20 Jahre auf dem Buckel hat, hört man ihm ob der klanglichen Sauberkeit und Transparenz keineswegs an.
Ein zeitlos schönes Album – das Meisterstück von This Mortal Coil.http://www.youtube.com/watch?v=01o6AB8MKyg
http://www.youtube.com/watch?v=usYEImDgztM
http://www.youtube.com/watch?v=vlWJozNRVHw30. Siouxsie and the Banshees – Peepshow

Haben sie sich erstmal ihre Schublade geschaffen, kamen sie da nur schwerlich wieder raus: nach „Juju“ begannen die Banshees zu experimentieren und sich vom selbst miterschaffenen Gothic-Begriff zu distanzieren, mussten sich jedoch trotz anderer Ambitionen immer an Szene-Ansprüchen messen lassen, durchbrachen nie die auch selbstauferlegten Barrieren. Mit einem kokettem Blick und einer galanten Handbewegung des Openers war damit jedoch Schluss. „Peek-a-Boo“ ist eine völlig untypische Halloweenreim trifft Disco trifft Kabarett-Nummer, die von frühen Anhängern der Band sofort leidenschaftlich gehasst wurde, die Band einen großen Teil ihrer Authentizität kostete und letztendlich eine völlig neue Herangehensweise ermöglichte. Willkommen im dunkelbunten Märchenschloss zur Peepshow/Rocky Horror Picture Show von Siouxsie and the Banshees! Das leicht an „Spellbound“ von „Juju“ erinnernde „The Killing Jar“ und „Burn-Up“, das gleichzeitig nach Rodeo und Disco klingt, sind luftige, leichtfüßige, lupenreine Popsongs, die zumindest in der Form auf den frühen Alben nicht denkbar gewesen wären. Auch durchaus an die Vergangenheit angelehnte Songs wie „Ornaments of Gold“ und „Turn to Stone“, relativ düstere („Scarecrow“) und sperrige („Carousel“) Stücke klingen nun angenehm ballastfrei. Man merkt der Band die Freiheit an, die mit dem so nachdrücklich und effektiv ruinierten Ruf einherging, und besonders Madame Siouxsie Sioux klingt charismatisch wie eh und je. Die Diva führt mit einer bemerkenswerten Selbstsicherheit durch den inszenierten Showverlauf. Abgeschlossen würde „Peepshow“ von „The Last Beat Of My Heart“ werden, einer zarten, leicht sentimentalen Akkordeon-/Streicher-Ballade…wenn, ja, wenn es sich die Banshees nicht anders überlegt hätten. Das opernhaft gesungene, dramatische „Rhapsody“ lässt das vorher so hübsch aufgebaute Märchenschloss mit Karacho einstürzen.
Das 1988er „Peepshow“ ist eine bizarre, poppige und experimentelle, herrlich kitschige, ironische und dekadente Platte. Mit beachtlicher Stilsicherheit und neugewonnener künstlerischer Reife richtet man sich wieder nach dem Grundsatz des 1977er Debüts „The Scream“: Habe keine Angst davor, billig zu sein. Und obwohl man mit dem Album eigentlich gar nicht mehr wirklich der Szene angehörte, war es neben den großen Werken zu Anfang der Bandkarriere gerade „Peepshow“, das Gothic mitdefinierte und ihm ein neues Gesicht gab. Leider hatte man danach etwas die Zügel schleifen lassen, doch „Peepshow“ ist und bleibt für mich das Meisterwerk von Siouxsie and the Banshees.
http://www.youtube.com/watch?v=i41W-NIjMfs
http://www.youtube.com/watch?v=blGPnobxTiM
http://www.youtube.com/watch?v=0Ul7bqFguPg
http://www.youtube.com/watch?v=i2RHAOGuFGg29. Placebo – Without You I’m Nothing

Es ist ja irgendwie nicht so wirklich vorteilhaft, das beste Stück des Albums (und möglicherweise das beste Stück der gesamten Bandkarriere) gleich am Anfang zu präsentieren: „Pure Morning“ stützt sich auf einen monotonen, kalten Schlagzeugbeat, im Hintergrund wummern leicht überverzerrte, noisige Gitarren. Brian Molko klingt unbeteiligt und arrogant wie eh und je, wenn er diese Zeilen intoniert: A friend in need‘s a friend indeed ,a friend with weed is better. Wie wahr. Und es bestätigt sich hier auch eigentlich wieder das Vorurteil, Placebo wäre eine songorientiert arbeitende Band. Gleichzeitig zerschlagen Brian Molko, Stefan Olsdal und Steve Hewitt hier aber auch das daran gekoppelte Vorurteil, man würde von Placebo, wenn überhaupt, nur die Singles brauchen. „You Don’t Care About Us“, „Allergic (To Thoughts of Mother Earth)“ und natürlich „Every You Every Me“ sind luftige, lakonisch-melancholische, perfekt auf den Punkt gebrachte Popsongs, die elegant die Gewässer der Banalität umschiffen, doch „Without You I’m Nothing“ hat mehr zu bieten: das Titelstück klingt melodramatisch und schwer wie Blei. „My Sweet Prince“ und „Burger Queen“ sind stille und introspektive Songs, die in ihrem schwebend-sphärischen Sound genüsslich Radioformat und Singletauglichkeit ignorieren. „The Crawl“ suhlt sich in Niedergeschlagenheit und hat einen Basslauf, der wohl auch The Cure zu Zeiten von „Faith“ gut zu Gesicht gestanden hätte. „Scared of Girls“, einer der meiner Meinung nach besten und meistunterschätzten Songs von Placebo, lebt neben seiner Widerhaken-Melodie auch von seiner ungestümen, an Debüt-Tage erinnernden Energie.
„Without You I’m Nothing“ ist das Gesellen- und Meisterstück von Placebo. Den jugendlich-trotzigen Indie Rock des selbstbetitelten Debüts von 1996 verfeinerte man zwei Jahre später mit interessanten Details und ließ nur noch das Nötigste an Kanten in den Songs. Diese neugewonnene Reife hält sich die Balance mit einer jugendlichen Frische und Unverbrauchtheit, die auf den späteren Alben leider (naturgemäß) abhanden kam. Auch der Klang hat den übrigen Alben das rettende Bisschen Makellosigkeit voraus und außerdem perfektionierte Brian Molko hier seine Taktik, selbst trivialstes Blabla so zu formulieren oder zumindest gesanglich so auszudrücken, dass es Bedeutung bekam und diese sogleich durch Ironie gleich wieder etwas zu brechen, wenn er sich allzu pathetischen Gefilden näherte. Eine Gabe, die auf dem aktuellen Album „Battle For The Sun“ leider etwas verloren ging…aber das ist eine andere Geschichte.
http://www.youtube.com/watch?v=SwxwzBvuIpQ
http://www.youtube.com/watch?v=3_NME1Iu79U
http://www.youtube.com/watch?v=Yx41Hm0qcdQ28. New Model Army – Thunder and Consolation

New Model Army gründeten sich 1979 in Yorkshire und brachten vor allem während der ausklingenden Post Punk-Welle einige tolle Alben raus, von denen „Thunder and Consolation“, das 1989 erschienene vierte Album der Band, sicherlich das bemerkenswerteste ist. Der meist dunkel schattierte, Folk Rock-beeinflusste Punk/Alternative Rock mit seinen sehr dominanten und prägnanten Basslines und Justin Sullivans intelligenten, sozialkritischen Lyrics wurde hier auf den Punkt gebracht; nicht nur im Bezug auf NMAs Diskografie, auch allgemein gesehen ist „Thunder and Consolation“ für mich eines der vollkommensten Rockalben, die jemals veröffentlicht wurden.
„I Love The World“ ist ein gewaltiger Opener, der nicht besser hätte platziert werden können: über einem leicht hektischen und unheilverkündenden Basslauf und mit zorniger Stimme beschreibt Justin Sullivan den Zusammenbruch der modernen Zivilisation. Das Preludium zum Weltuntergang.
„Stupid Questions“ macht sich relativ gut in seinem Schatten. Ähnlich wie „225“, „Green and Grey“, „The Ballad of Bodmin Pill“ und „Vagabonds“ ist es einer dieser für New Model Army gewissermaßen typischen Songs: melancholisch und von akustischen bzw. eher unverzerrten Gitarren getragen, manchmal mit wehmütigen Violinen, einer dieser Songs, die man im Ohr hat, während man sentimental aus dem Zugfenster starrt, die auf dem ersten Blick zu bescheiden und unaufdringlich rüberkommen, um wirklich mitzureißen, die sich aber nach und nach ins Gedächtnis bohren und die sich rückblickend zu den wichtigsten des Lebens entwickelt haben könnten. „Thunder and Consoolation“ ist wohl das Meisterstück der bandeigenen Stimmung zwischen Aufbruchsstimmung und Working Man’s-Romantik.Vor allem Justins Sullivans Texte tragen daran einen nicht unerheblichen Anteil. Schon unzählige Male hat er mir mit seinem Umgang mit der englischen Sprache und seinen kritischen, an einem gewissen gesellschaftlichen Idealismus festhaltenden und auch seinen eher introspektiven Texten aus der Seele gesprochen, immer wieder haben mich die traurigen Geschichten von „Green and Grey“ und „Family Life“ berührt und beschäftigt. Dabei bemüht er sich nicht zwanghaft darum, irgendwelche bahnbrechenden Wahrheiten zu liefern oder den Sinn hinter Unmengen von bedeutungsschwangeren Phrasen und Metaphern zu verschleiern, seine Lyrics sind intelligent und schön formuliert, jedoch keineswegs gekünstelt. Gleiches gilt auch gewissermaßen für die Band: New Model Army spielen handgemachten, erdigen und ehrlichen Rock (wuäh…diese Beschreibung ist für mich unmittelbar an schmierige, öde Amirocker vom Format Nickelback und Epigonen sowie Böhze Onkelz gekoppelt, passt hier aber halt leider bestens), der nicht abwechselnd mit voll dolle ungewöhnlichen Arrangements und ach so komplexen Strukturen um die Aufmerksamkeit des Hörers buhlt, sondern schlichtweg Songwriting auf konstant sehr hohem Niveau bietet. Dieses folgt zwar relativ simplen Mustern, wirkt jedoch niemals banal oder langweilig, sondern besitzt immer eine angemessene Tiefe. Und mal ehrlich, wie viele Bands können von sich behaupten, über die volle Albumdistanz NUR Hits zu schreiben?
„Thunder and Consolation“ endet mit einem ähnlichen Paukenschlag wie dem, mit dem es begonnen hatte: „Archway Towers“ ist ein in jeder Hinsicht höchst untypischer Song und neben bereits erwähnten „I Love The World“, „Green and Grey“ und „The Ballad of Bodmin Pill“ vielleicht mein liebster des Albums. Die Lyrics sind kryptisch und bruchstückhaft ausgefallen. Es wird eine ungeheure Anspannung aufgebaut, die sich nur teilweise in gelegentlich angezerrten Gitarren entlädt. Man hat das angedeutete Grauen noch nicht ganz begriffen und sträubt sich vielleicht dagegen, wenn Sullivan schmerzverzehrt und mit Begleitung von laut aufheulenden Gitarren immer wieder „Nooooooo!“ schreit. Nachdem der Hörer nach gut drei Minuten denkt, der Song wäre zu Ende, lässt man ihn nach einem kurzen Break noch gut eine Minute lang mit dem bekannten Gitarrenmotiv ausklingen.
New Model Army sind bis heute aktiv und veröffentlichten vor einigen Monaten ihr elftes Studioalbum, jedoch konnte weder einer der Nachfolger noch einer der Vorgänger an die kompositorische Klasse, Reife und Hitdichte, aber auch die Energie und die Aura von „Thunder and Consolation“ heranreichen. Wie schon erwähnt: für mich eines der wenigen wirklich makellosen Rockalben und eines der besten aller Zeiten.
http://www.youtube.com/watch?v=xnZD61tynS4
http://www.youtube.com/watch?v=SJnCHctOeJg
http://www.youtube.com/watch?v=yCOjJh4LNkA (Doofiquali :/)27. Depeche Mode – Songs of Faith and Devotion

Depeche Mode sind sicherlich eine wichtige und einflussreiche Band und haben eine spannende Entwicklung hinter sich, doch trotzdem interessierten sie mich nur 4 Alben lang. Das erste DM-Album, das mein Interesse erweckte, erschien 1986 unter dem Titel „Black Celebration“. Was Ende 70er/Anfang 80er noch mit putzigen Buben in komischer 80er-Kleidung, die ihre Synthie Pop-Songs zugegebenermaßen immer weiter über dem Radio-Einheitsbrei platzierten und sich vorsichtig dem Anspruch annäherten, anfing, war nur der Weg zum Ziel, ein Meisterwerk zu erschaffen. Doch ganz wurde es nicht erreicht, „Black Celebration“ ist in den Details durchaus noch verbesserungswürdig, doch es löst zumindest teilweise die Versprechen ein, die auf den Vorgängeralben gemacht wurden. Der selbstironisch betitelte Nachfolger „Music for the Masses“ ist da schon wesentlich ausgefeilter. Nach außen hin ein sehr gutes Pop-Album, doch innen brodelt die Experimentierfreude, was sich besonders in der großartigen Soundcollage „Pimpf“ äußert. Mit „Violator“ erreichten Depeche Mode Anfang der 90er ihren vorläufigen kreativen Höhepunkt. Ein perfektes Pop-Konstrukt, diesmal sogar mit eindeutigeren Singlekandidaten, ohne dabei die experimentelle Ebene des Vorgängers zu verlassen, teilweise sogar noch ’ne Schippe dunkler. Doch auch wenn die Kompositionen tiefergehender wurden, auch wenn sich „Clean“ gefährlich nahe dem Abgrund aufhielt, so pochte tief im Körper von „Violator“ immer noch kein menschliches Herz. 1993 sollte mit dieser inszenierten Kälte und Distanziertheit Schluss sein.
Nach dem Erfolg von „Violator“ konnte es in kreativer, vielleicht sogar auch in kommerzieller Hinsicht nicht mehr so weitergehen. Depeche Mode brauchten 3 Jahre, um sich mit „Songs of Faith and Devotion“ neu zu erfinden. In diesen 3 Jahren sind die distanzierten Synthie Popper zu Rockstar-Karikaturen verkommen, konnten sich bei den Aufnahmen nicht mehr leiden, Dave Gahan nahm Drogen und ging gar nicht mehr zum Frisör! Krass. Eigentlich fast schon mit ein Grund, warum SOFAD so geworden ist, wie es ist. Gab es auf „Violator“, vielleicht sogar schon auf „Black Celebration“ („Stripped“) zaghafte Annäherungen an Rock, so wurde diese Vorsicht beim Opener „I Feel You“ ohne Rücksicht auf Verluste über Bord geworfen. „I Feel You“ ist ein lärmender, nicht unbedingt eleganter, aber ausgesprochen sexy Befreiungsschlag. Depeche Mode entledigen sich von der vorherrschenden, durchaus beabsichtigten Seelenlosigkeit und Unterkühltheit früherer Alben und suhlen sich in Leidenschaft. Diese heulenden Gitarren und Gahans relativ enthemmter Gesang stießen damals bestimmt so einige Depeche Mode-Fans vor den Kopf, hihi. „Walking In My Shoes“ klingt musikalisch schon wesentlich vertrauter, der melancholische Synthienebel umhüllt den hintergründig hämischen Text; You stumble in my footsteps, keep the same appointments I kept, if you try walking in my shoes. “Condemnation” klingt mit seinen Gospel-Einflüssen recht ungewöhnlich, man spürt direkt die kreative Narrenfreiheit, der sich DM auf SOFAD nur allzu bewusst sind. Vor allem fällt auf, wie sehr Dave Gahan als Sänger gewachsen ist. War er früher nur eine schöne, im Grunde austauschbare Stimme, die die Songs von Martin L. Gore intonierte, entwickelt er jetzt Persönlichkeit, kann Emotionen sehr facettenreich vermitteln. „Mercy in You“ wäre im Grunde vollkommen unauffällig, wäre da nicht dieser sehr simple, aber wunderschöne Refrain. The meeeercy iiin you. Hach, herrlich. Über den verfügt „Judas“ leider nicht. Luftiger, aber nicht sonderlich spannender Electropop, vielleicht bewusst vor der absoluten Großtat in DMs Karriere platziert; „In Your Room“ ist so ziemlich der beste Song, den Depeche Mode je geschrieben haben. Von der Struktur erinnert er durchaus an „How Soon Is Now?“ von The Smiths, klingt dabei jedoch, und ich hätte nie gedacht, dass ich das mal von einem Depeche Mode-Song sagen würde, wesentlich treibender, flehender, emotionaler, obsessiver. „Get Right With Me“ flirtet erneut mit Gospel-Einflüssen, die in dieser Klangkulisse jedoch beinahe grotesk klingen. Interessanter Effekt. „Rush“ hält, was der Titel verspricht (nein, ich meine nicht damit, dass der Song nach der kanadischen Progressive Rock-Band klingt *g* ). Pumpender Rhythmus, etwas aufdringliche Synthies, eine treibende, berauschende Hetzjagd durch nächtliche Großstädte, bei der man das, was um einen herum geschieht, nur verschwommen wahrnimmt. Nach diesen unter der ohrwürmeligen Oberfläche beinahe abgründigen Songs ist „One Caress“ ein gewöhnungsbedürftiger und extremer Kontrast. Die überzuckerten Streicher und die fast schon positive Grundstimmung werden von einer kleinen, unauffälligen Textzeile entschärft: Lead me into your darkness, when this world is trying its hardest to leave me unimpressed . „Higher Love“ bildet einen ruhigen, melancholischen, relativ unspannenden, aber passend gesetzten Abschluss für SOFAD.
Mittlerweile können Depeche Mode alles ohne jedes Risiko auf ihren Alben machen, die Leute würden sie trotzdem wie blöd kaufen, aber sie wollen es wohl gar nicht mehr. Sie veröffentlichen weiter munter gute Alben, denen der kreative Spirit fehlt, und stehen auch nach 30 Jahren Bandkarriere und als eine der erfolgreichsten Bands aller Zeiten im Schatten oder auch auf dem Fundament von „Just Can’t Get Enough“, „People Are People“ und „Everything Counts“. Sie leben von diesen und ähnlichen Songs, von ihrem sauberen Image und ihrer seriösen Harmlosigkeit, für mich wurden Depeche Mode aber erst dann richtig toll, als sie einen Anschlag eben darauf verübten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dieses (im Übrigen von Flood brillant produzierte; würde ich es nicht besser wissen, käme ich nie auf den Gedanken, dass SOFAD bereits mehr als 15 Jahre auf dem Buckel hat) Album ohne den beschriebenen Kontext noch so toll finden würde wie jetzt, im Zusammenhang mit der Bandlaufbahn betrachtet ist es mir aber immerhin einen siebenundzwanzigsten Platz bei meinen All Time-Faves wert. :angel:
http://www.youtube.com/watch?v=SdCmzSJD6rk&feature=PlayList&p=361D032DF30745BF&playnext=1&playnext_from=PL&index=28
http://www.youtube.com/watch?v=jKgQNvK4D8Y
http://www.youtube.com/watch?v=H8clZpD_ZBA--
trying to leave [COLOR=#808080]a mark more permanent than myself[/COLOR]Hmm, ein paar interessante Dinge bei, von Bauhaus brauch ich auch mal was.
Das ist allerdings unfassbar scheiße, die anderen Lieder gehen ja zumindest. Da ist mir das alte Zeug lieber.
--
Support the dying cult of underground metal! Stay black and brutal forever! If it was not for my parents I would have tried to kill myself before Instead i listend to Slayer and dreamt on A world without war is like a city without whores26. Katatonia – The Great Cold Distance

Mit ihrem Zweitwerk von 1996 haben Katatonia es sich vergleichsweise leicht gemacht: „Brave Murder Day“ lebte von seiner gewissermaßen typisch jugendlichen emotionalen Unmittelbarkeit, von seiner höchst effektiven Simplizität. Imperfektion war damals nicht nur unmöglich zu vermeiden, sondern sogar vonnöten. Es ist erstaunlich, wie weit sich Katatonia von diesem Ideal mit „The Great Cold Distance“ entfernt haben. Der karge Midtempo-Deathdoom (sic!) wich einem recht kopflastigen, modernen, sehr eigenständigen Sound im weiten Spannungsfeld von Alternative Rock und Dark Metal. Zugegeben, zwischen den Alben liegen zehn Jahre, Jahre der Experimente und der Selbstfindung, und doch ist es bei näherer Betrachtung faszinierend, dass Katatonia an ihren Klassiker herankommen, ihn eigentlich sogar übertreffen konnten, mit einem Album, das mit BMD wenig bis gar nichts gemeinsam hat.
Mit „Viva Emptiness“ entdeckten Katatonia komplexere Arrangements und Songmuster, erst mit TGCD den zur Ausführung und Einbindung dieser nötigen Perfektionismus. Jedes Break und jedes Riff ist perfekt auf einander abgestimmt, jedes Detail, das man sonst, um das Flair und die Spontanität des ersten Takes zu wahren, im Songgebilde untergehen ließ, wurde nun mit fast krankhafter Präzision ausgearbeitet. Im glasklaren Sound hört man selbst noch das tiefste Basswummern. Zwar entfernte man sich auch auf „The Great Cold Distance“ nicht wesentlich mehr als auf „Viva Emptiness“ von einem konventionellen Songaufbau, doch innerhalb dessen erreicht die Verspieltheit des Drummings fast schon Tool’sche Ausmaße. Nun soll das aber nicht heißen, „The Great Cold Distance“ ließe die Emotionalität und Atmosphäre früherer Alben missen – ganz im Gegenteil. Während die Vorgängerwerke von geradezu zufälligen Treffern dieser Art lebten, zielen Katatonia nun mit bemerkenswerter, fast mathematischer Konzentration und Präzision auf den wunden Punkt des Hörers. Die Band operiert hier mit einem über die Jahre geschliffenen, infolgedessen aber auch äußerst scharfen Seziermesser. Man muss auch ob dieser sehr berechnenden Herangehensweise nicht unbedingt auf die obligatorischen Seelenwärmer-Melodien verzichten: die Singleauskopplung „My Twin“ schmiegt sich sofort an die Gehörgänge. Das erschöpft taumelnde „Journey Through Pressure“ fängt einen wunderbar sanft wieder auf und ist ein perfekt gesetzter Schlusstrack. „In The White“ hat einen schlichtweg brillanten Refrain, der selbst Kuschelkatatonia auf „Last Fair Deal Gone Down“ in der Form nicht gelungen ist.
Doch sind es nicht diese Momente, die „The Great Cold Distance“ ausmachen, es ist eher die kalte, entmenschlichte Atmosphäre, unter der sich „Deliberation“ nicht frei entfalten kann und die „Follower“ zum Ideal erklärt, es ist eher die erstaunliche, doch diesmal fast mechanische Härte, mit der „Consternation“, „Increase“ und „The Itch“ vorgehen. Es sind nicht die wärmenden, tröstenden Momente, oder zumindest nicht ganz unterdrückte Ausbrüche von Verzweiflung, von denen das Album lebt, sondern die monochrome Trostlosigkeit, das inszenierte Dystopia aus fremden, ausdruckslosen Gesichtern und Beton, die große kalte zwischenmenschliche Distanz, an der nicht zuletzt auch das sehr gelungene Artwork und die sowohl abstrakten als auch klar formulierten Lyrics von Jonas Renkse einen großen Anteil tragen. Man überwindet vielleicht die abweisende Distanziertheit von „The Great Cold Distance“, man dringt an sein zerbrechliches, flehendes, hilfloses Inneres und stößt schlussendlich auf einen resignierten, erkalteten, leblosen Kern. Letztendlich hat man der unüberbrückbaren Unnahbarkeit und Apathie der modernen Welt nichts entgegenzusetzen. Kaum eine Band hat diese Stimmung so gut vermittelt wie Katatonia auf „The Great Cold Distance“.
http://www.youtube.com/watch?v=6ow7rqkY-jI (tolles Video auch, das die auf dem Album vermittelte Atmosphäre visuell sehr gut einfängt)
http://www.youtube.com/watch?v=sCYPUgb370I
http://www.youtube.com/watch?v=qNPKRYovvi825. The Gathering – How To Measure a Planet?

Nach der streckenweise nicht ganz ausgereiften Genre-Blaupause „Mandylion“ veröffentlichten die Holländer 1997 mit ihrem vierten Album „Nighttime Birds“ auch gleich die klanggewordene Vervollkommnung des Gothic Metal, einen ausgefeilt und durchdacht arrangierten, elegisch-schönen, Prog Rock-beeinflussten Traum von einem Album. Doch war diesem Sound noch irgendetwas hinzuzufügen? Konnte man „Nighttime Birds Pt. II“ aufnehmen, nachdem man sich als eine der wichtigsten und vor allem wegweisendsten Bands des sich auf seinem Höhepunkt befindenden Genres erwiesen hat?
The Gathering haben offenbar beide Fragen verneint und sich ein Jahr später mit „How To Measure a Planet?“ vom mitdefinierten Stil entfernt. Die leicht progressiven Ansätze des Vorgängers wurden weiter ausgebaut, die Gitarren in den Hintergrund gedrängt, der hohe Ambient- und Trip Hop-Einfluss ließ auf ein reges Interesse an Brian Eno, späten Slowdive und Massive Attack schließen. Ihren Höhepunkt findet die Experimentierfreude im fast halbstündigen Titelstück, das sich nach und nach von seiner Struktur löst und zum Schluss klingt wie eine Mischung aus Eno-eskem Traumambient und der sich um Millimeter verschiebenden Repetitivität von Steve Reichs „Come Out“. Ein auf dem ersten Blick drastischer Kurswechsel, mit dem The Gathering Fans von „Nighttime Birds“ und insbesondere „Mandylion“ auf den Schlips getreten waren – dabei hat bei näherer Betrachtung gar kein wirklicher Stilbruch stattgefunden. Die getragenen, schwelgerisch-schönen Melodien, der herzerwärmende Gesang von Anneke van Giersbergen, sie sind immer noch da und stehen nun sogar noch weiter im Vordergrund, bloß in einem neuen Gewand. Der Frage, ob man den Stil von The Gathering nun als Gothic Metal oder „Trip Rock“ bezeichnen sollte, muss man insofern keine allzu große Bedeutung beimessen.
Die elektronischen Soundscapes geben dem Klang des Albums etwas eigentümlich Elektrisches, eine Art künstliche Wärme. „How To Measure a Planet?“ klingt über weite Strecken (mit Ausnahme der wunderschönen halbakustischen Ballade „My Electricity“) fremdartig und futuristisch. Der Grund, warum man sich in der hier aufgebauten Welt nie verloren, sondern immer absolut wohl und geborgen fühlt, ist der kraft- und gefühlvolle, glockenhelle Gesang von Anneke van Giersbergen. In keine Sängerin aus dem Metal-Umfeld war ich jemals so rettungslos verschossen wie in sie. Mit ihrer Stimme fängt sie auf und spendet Trost und Wärme, setzt der Konfusion ein Ende und macht viele der eher schlicht arrangierten, auf ihren Gesang abgestimmten Songs erst zu richtigen Perlen. Über weite Strecken fließen die Stücke leicht melancholisch und wunderbar entspannt, doch The Gathering wissen auch mit Dynamik und Kontrapunkten umzugehen, ohne dass es der Atmosphäre einen Abbruch tut. „Liberty Bell“ beispielsweise ist eine wunderbar erdlosgelöste, kraftvolle, mitreißende Spacepop-Nummer, „Illuminating“ versprüht im Refrain eine ansteckende Euphorie, „Probably Built In The Fifties“ klingt dynamischer und energischer als alles, was diese Band in ihrer Metal-Phase geschrieben hat und die Streicher von „Red Is A Slow Colour“ und die Gitarren und Effekte von „Rescue Me“ entwickeln irgendwann ein Eigenleben. Diese Songs sind es auch, die einzeln am besten funktionieren, doch entfalten die Stücke von „How To Measure a Planet“ ihre Wirkung, ihre ganz besondere Magie erst im Albumzusammenhang gehört, als ein Werk von beeindruckender in-sich-Geschlossenheit und Homogenität. Das eigentliche Herzstück des Albums, der Song, der mich immer noch am meisten berührt und vielleicht sogar mein absoluter Lieblingssong der Band, ist indes „Travel“: getragen von Streichern und schwebenden Gitarren nimmt er den Hörer mit auf eine wunderschöne Traumreise. Einer der größten Augenblicke des Stücks und des Albums ist der Gesangseinsatz und diese unheimlich weit ausholende Gänsehaut-Melodie gegen Ende, die schlichtweg nicht von dieser Welt sein kann: I wish you knew your music was to stay forever and I hope… Die unendliche Weite des Himmels in kompakten neun Minuten.
Nach HTMAP? stellte sich eine andere Frage: was machen The Gathering, nun, da ihnen alle Türen offen standen? Nach elf Jahren, fünf weiteren Studioalben auf durchgehend (sehr) hohem Niveau (bis einschl. „Home“) und einem aus meiner Sicht nicht unbedingt vorteilhaften Wechsel am Mikro (obgleich ihr Projekt Aqua de Annique über weite Strecken erschreckend fad daherkommt, stieg und fiel die Qualität der Stücke meist mit Annekes Präsenz und Charisma, da braucht man sich nichts vorzumachen) bleibt als Fazit zu sagen: nichts wirklich Besonderes. Zwar konnte man seinen Sound besonders auf „Souvenirs“ um einige feine Nuancen erweitern, ihm aber nichts wirklich Entscheidendes hinzufügen.
http://www.youtube.com/watch?v=Dcm6xRORFU8
http://www.youtube.com/watch?v=oNYg2iTEhmA
http://www.youtube.com/watch?v=WMv8GXhxjCU24. Elend – Les Ténèbres Du Dehors
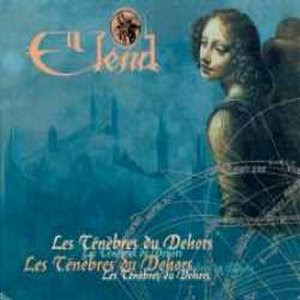
Lost in a dream…
Drowning in the eyes
Of a statue who dreamt a little dream of me…Flächige Keyboardklänge. Zarter Soprangesang.
But here there is no light.
Dieser Satz ist, wenn man so will, der eigentliche, unheilsverkündende Anfang von „Les Ténèbres Du Dehors“, dem 1996 erschienenen Zweitwerk der französisch-österreichischen Neoklassik-Formation Elend. Es ist der zweite Teil der „Officium Tenebrarum“-Trilogie, einem Konzeptwerk um John Miltons „Paradise Lost“, die Rebellion und den Fall des ehemaligen Erzengels Luzifer (im wunderschön aufgemachten Booklet sind passend dazu Stiche von Gustave Doré und das Thema aufarbeitende Lyrics in Englisch, Französisch, Griechisch und Hebräisch abgebildet). Die relativ zurückgenommene, geradezu minimalistische Vorgehensweise, die den Vorgänger „Leçons de Ténèbres“ noch bestimmt hat, legte man ad acta, die Kompositionen haben deutlich an Länge und Komplexität, vor allem aber Bombast zugenommen. Die kunstvoll aufgebauten Symphonien wogen und erstürmen himmlische Höhen, nur um dann wieder in sich zusammenzufallen und den Hörer in eine bodenlose Schlucht zu stürzen. Engelhafte Sopranstimmen umspielen hochfliegende Streicherwinde und filigrane, betörende, von Chorälen getragene Melodien stützen sich auf sakrale Keyboardtürme. Wirkte er auf dem Debüt noch recht verloren, so fügt sich der Schreigesang Renaud Tschirners in dieser Klangkulisse wunderbar ins Bild ein und verleiht dem Sound von Elend seine Tiefe, Verzweiflung und Abgründigkeit. Dieser ist auch der Grund, warum Elend in bestimmten Teilen der Metalszene einen guten Ruf genießen – auf ein solches Instrumentarium griff das Kollektiv nie zurück. Eher berief man sich auf die klassische Musik des frühen zwanzigsten Jahrhunderts, aber auch auf große Komponisten wie Bach, Chopin und Vivaldi. Zeitweise klingen Elend wie Dead Can Dance mit einer pechschwarzen Seele.
Elend erschaffen auf „Les Ténèbres Du Dehors“ eine Klangkathedrale von einschüchternder, aber auch höchst ästhetischer und beeindruckender Architektur. Als mustergültiges Beispiel für die Effektivität, Atmosphäre und Tragweite von „Les Ténèbres Du Dehors“ dient „The Luciferian Revolution“: der Zusammenbruch und der Taumel am Ende jagen mir jedes Mal wieder eine Gänsehaut über den Rücken. Einzig den manchmal etwas künstlichen Klang der Streicher und der Keyboards könnte man bemängeln, doch gemessen daran, dass Elend hier zwar ein echter 12-Personen-Chor, nicht jedoch ein echtes Orchester zur Verfügung stand, ist das Ergebnis beeindruckend wohlklingend.
Ein Meisterwerk – zwei Jahre später sollten Elend es jedoch sogar noch übertreffen.http://www.youtube.com/watch?v=VI4LYpgXm9Y
http://www.youtube.com/watch?v=SfuGHE_8tNE
http://www.youtube.com/watch?v=T3DJKDsNL0k
http://www.youtube.com/watch?v=X742hwYnujM23. Elend – The Umbersun

A shadow of horror is risen.
Dieser Textauszug steht sinnbildlich für die Stimmung von „The Umbersun“, des letzten Teils der „Officium Tenebrarum“-Trilogie von Elend. War schon sein direkter Vorgänger „Les Ténèbres Du Dehors“ geprägt von äußerster Finsternis und Tristesse, so setzt „The Umbersun“ noch einen drauf – in jederlei Hinsicht. Der Sound ist (noch) dichter und voluminöser, vom etwas künstlichen Klang der Keyboards und der Streicher ist nichts übrig geblieben. Ebenfalls (fast) nichts übrig geblieben ist von der Ästhetik, Schönheit und Eleganz, die „Les Ténèbres Du Dehors“ noch ausmachte, nichts auf diesem Werk, nicht eine einzige Note könnte so bezeichnet werden. Es gibt sie zwar, die Momente, in denen die Melodie kurz Überhand gewinnt und in denen das flammende Inferno sich kurz legt, doch sind sie in diesem Kontext von keiner großen Bedeutung, höchstens unheilverkündend, der Umgang mit ihnen reine Formalität. Zu Tausenden, von allen Seiten und in höllischen, ohrenbetäubenden Kaskaden aus Dissonanz prasseln die Klänge auf den Hörer ein; schon allein um diesen Sinneseindruck vollstens auf sich wirken lassen zu können, sind Kopfhörer oberste Pflicht. Die Streicher wirbeln in schwindelerregender Geschwindigkeit umeinander. Chöre duellieren sich, die Stimmen erklimmen Höhen, dass einem die Luftzufuhr abgeschnitten wird. Das hier hat nun nichts mehr von der früheren sakralen Schönheit, dies ist ihr sinisteres, unheiliges Gegenteil. Der Sound hat eine Dichte, in der es keine Klanglöcher und Verschnaufpausen gibt, und ist gleichzeitig von bemerkenswerter, erbarmungsloser Transparenz. Manchmal bahnt sich eine schrille, schier durchdringend hohe, gepeinigte Geige ihren Weg. Man versucht vergebens, sich bei diesen Symphonies of Destruction an einer klar erkennbaren Struktur festzuhalten – „The Umbersun“ ist ein stundenlanger Fall ins Licht- und Bodenlose. Ein Paradebeispiel für diese höchst einnehmende Atmosphäre ist das ausgesprochen treffend betitelte „Apocalypse“; der Einsatz der rituellen Trommeln ist der Spannungshöhepunkt von „The Umbersun“.
„The Umbersun“ steht dem Frühwerk von Diamanda Galas somit deutlich näher als Black Tape For A Blue Girl oder Dead Can Dance. Vor allem aber lässt es in seiner Wirkung alle (mir bekannten) Alben aus dem Black-/Death-/Schlagmichtot-Umfeld weit hinter sich.
Nach dem Ende der „Officium Tenebrarum“-Trilogie sollten Elend sich zumindest vorläufig auflösen. 2003, fünf Jahre nach Veröffentlichung von „The Umbersun“, begannen sie eine neue Trilogie, den „Winds Cycle“, bei dem die Kompositionen kompakter und weniger symphonisch wurden und man mit Industrial- und Dark Ambient-Sounds experimentierte. Nach „A World in Their Screams“ löste man Elend erneut auf, diesmal aus finanziellen Gründen (das Arrangieren und Aufnehmen der Stücke war zu umfangreich und somit nicht mehr tragbar) – der „Winds Cycle“ war ursprünglich als Fünfteiler geplant.
http://www.youtube.com/watch?v=_idNE-oZBZA
http://www.youtube.com/watch?v=1nLpNlXV7Wo
http://www.youtube.com/watch?v=QJSAx032wBs22. Einstürzende Neubauten – 1/2 Mensch

Halber Mensch
Halber Mensch
Halber Mensch…Ein benommener Frauenchor, wie hypnotisiert und Seele und Hirn beraubt.
GEH WEITER!!!
IN JEDE RICHTUNG!!!
WIR HABEN WAHRHEITEN FÜR DICH AUFGESTELLT!!!Das Titelstück des dritten Albums von Einstürzende Neubauten fängt an. Ein Chor gleichgeschalteter Seelenloser und Blixa Bargelds von jeder Ecke des Raumes zurückgeworfene Stimme.
Sieh deine 2. Hälfte
Die scheinbar grundlos schreiend erwacht
Schreiend näherkommt
Du siehst sie nicht
Bist gefesselt vom AbendprogrammEin Bild, das durch den realen Bezug noch mehr Beklemmnis und Verstörtheit auslöst.
Du formlose Knete
Aus der die Lebensgeister den letzten Rest Funken aussaugen
Fliegen taumelnd, besoffen davon
Tanzen nutzlos in der SonneBargeld würgt diese Zeiten unglaublich verächtlich und angewidert aus sich heraus.
Einstürzende Neubauten waren bei ihrer Gründung noch so etwas wie ein sehr merkwürdiger Aprilscherz. Ein Aprilscherz, bei dem einem das Lachen im Halse stecken blieb. Inmitten der Post-Punk-Bewegung und des in ihrem Schoß aufblühenden Industrial-Genres wurde „Kollaps“ veröffentlicht, ein lärmiges, gnadenlos rhythmisches Konstrukt, das sich grundlegend von allem unterschied, was damals unter „Post-Punk“ und ähnlichen Begriffen zusammengefasst wurde und gerade deshalb, wegen dieser grenzüberschreitenden Ästhetik, doch ein wichtiger Bestandteil und Meilenstein dieser Bewegung wurde. Titel wie „Schmerzen hören“ und „Hirnsäge“ sprachen eine klare Sprache. Schon mit dem Nachfolger „Zeichnungen des Patienten O.T.“ verabschiedete man sich von dieser direkten, überverzerrten Vorgehensweise – harmonischer oder verdaulicher ist man indes keineswegs geworden. Die Interessierten und Faszinierten, die sich „D.N.S. Wasserturm“ angehört hatten, wendeten sich entweder verständnislos oder angewidert ab oder aber sie waren für ihr Leben versaut. Beide Werke waren offensiv, provokant, grausam, artifiziell und radikal. So vertrauenserweckend wie ein Flugzeug aus verseuchtem Industriemüll und so schön wie ein Autounfall.
Lass uns noch etwas Wodka holen, russische Vitamine…Drumbeat aus der Hölle, wie er stumpfer, nervenzerfetzender und zwingender …dübelt sich in meinen Kopf… nicht eingefallen wäre. Wovon reden wir denn die ganze Zeit? Zieh! Pssst! Die Effekte könnten in einem früheren Leben Streicher gewesen sein…NUMB YOUR IDEALS!!! Jetzt Messerwetzen. Irgendwo Geklimper auf Küchenbesteck. Ich bin 12 Meter groß und alles ist unvorstellbar!!! Keyboard wird malträtiert, die Wände kommen näher. Yü-Gung kann Berge versetzen.
Auch auf das dritte, 1985 veröffentlichte Album der Neubauten traf dies zu. Aber sie schrieben nun tatsächlich Songs. Songs, wie sie in der damaligen Neubauten-Welt halt so aussahen, aber den Satz konnte man jetzt sagen, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen – auch wenn man sich bei der Aussprache doch noch einige Male verschluckte. Wem würde man es übelnehmen, wenn er im Taxi zu heulen anfangen würde, während das gequälte, zwischen völliger Stille und ohrenbetäubendem Lärm pendelnde „Seele brennt“ läuft? Was für ein komplett verkorkstes Körpergefühl muss man haben, um den Z.N.S. zu tanzen? Und doch; allen Songs obliegt eine (nicht unbedingt herkömmliche) Struktur, „Yü-Gung (fütter mein Ego)“ sogar ein richtig tanzbarer Rhythmus und „Letztes Biest (am Himmel)“ eine melancholische Melodie. Sie sind nicht wirklich weniger drastisch oder weniger verstörend geworden, aber auf jeden Fall weniger destruktiv. Schon hier zeichnet sich das spätere Seilziehen von Harmonie & Struktur und Noise ab, auch wenn noch nicht vorstellbar war, wer es später gewinnen würde. Bis dahin aber:
Sag auf Wiedersehn zum Nervensystem.
http://www.youtube.com/watch?v=y0LF6WA9rxI
http://www.youtube.com/watch?v=NuBYmqK2w48
http://www.youtube.com/watch?v=Ou6kN-XUh_U--
trying to leave [COLOR=#808080]a mark more permanent than myself[/COLOR]
AnonymInaktivRegistriert seit: 01.01.1970
Beiträge: 0
palez Respekt für die tollen geschriebenen Reviews. Die machen richtig Lust die Alben zu hören. Hab auch viel neues für mich entdeckt….
--
Wie ich einfach mal so gut wie nichts aus deiner Liste kenne. XD
TwistOfFateHab auch viel neues für mich entdeckt….
Freut mich natürlich, das zu lesen. 🙂
Und danke für die Blumen!xTOOLxWie ich einfach mal so gut wie nichts aus deiner Liste kenne. XD
Eine gute Gelegenheit, mal ein paar Wissenslücken zu schließen, oder? 😉
Außerdem kommt gewiss noch mindestens ein Album, das du kennst…:-X21. Einstürzende Neubauten – Haus der Lüge

Sein (mittlerweile Ex-)Arbeitgeber muss seine Spuren hinterlassen haben: ähnlich wie bei Nick Cave and the Bad Seeds gab es auch bei Einstürzende Neubauten eine relativ drastische Kursänderung weg vom lärmigen, sperrigen, konfrontativen Sound hin zu harmonischeren, subtileren Klängen. Bei beiden Formationen ein durchaus fließender und langwieriger Prozess, doch ähnlich wie das ein Jahr zuvor veröffentlichte „Tender Prey“ steht bei den Neubauten das 1989er „Haus der Lüge“ sinnbildlich für diese Wendung.
Die Industrial-Lärmeskapaden sind immer noch integraler Bestandteil der Musik, doch selten wirklich dominierend. Beim Seilziehen von Harmonie & Struktur und Noise haben Erstere das Seil bereits auf ihrer Seite – glücklicherweise ist der Kampf immer noch durchzogen von Spannungen. Im benommen groovenden „Schwindel“, „Feurio!“ und „Haus der Lüge“ wird der industrialisierte Krach Mittel zum Zweck, die Zerstörung nachdrücklich und konsequent zur Schöpfung, zu geradezu teuflisch tanzbaren Songs, was einst zwar Ansätze in diese Richtung zeigte, für die Beschreibung „tanzbar“ aber schlichtweg zu kaputt war. „Feurio!“ ist im Grunde EBM im Neubauten-Kontext, von einer irren Energie, aber immer noch ausreichend, um einigen engstirnigen Vertretern der frühen Neubauten-Fanschar auf den Schlips zu treten. Auch eine Art der Konfrontation. Der Titelsong ist eines der bisher besten Beispiele der Band für perfekt gebändigten Noise, einen vollkommen makellos auf den Punkt gebrachten Song – und vor allem einer der besten Texte von Blixa Bargeld. Filigran-knorrende erzählende Architektur, ein Gedankenkonstrukt, dessen Botschaft scheinbar unmissverständlich ist, dessen zahlreiche sprachliche Finessen aber höchst mehrdeutig und eindrucksvoll Haken schlagen.
Nun war dies zwar eindeutig ein Resultat einer veränderten Arbeitsweise, doch kein wirklich drastischer Bruch mit dem alten Neubauten-Sound – sondern das zwölfminütige, in drei Teile gegliederte Album-Herzstück „Fiat Lux“. Über das imaginäre Trümmerfeld, das sich immer noch vor dem inneren Auge erstreckt, steigt nun so etwas wie Hoffnung auf. Ohne Hintergedanken, ohne Zynismus, von einer ungeahnten Schönheit. Keine Aufnahmen der 1. Mai-Demos in Berlin in „Manifestspiele“, kein seltsames, hektisches „Hirnlego“ kann dieses Flirren, diese Schönheit unter sich begraben. Vielleicht tatsächlich eine Art Wendepunkt, vielleicht wirklich der Grund, warum „Haus der Lüge“ der Ruf eines Übergangsalbums nachhängt. Vielleicht auch der wirkliche Grundstein für die gemäßigteren Folgealben. Was diesen aber fehlte, was eigentlich auch auf den frühen Alben nicht zu vernehmen war, was „Haus der Lüge“ ausmacht, ist die bereits erwähnte musikalische Spannung der verschiedenen Elemente. In dem Sinne, oder wie auch immer:
Gott hat sich erschossen, ein Dachgeschoss wird ausgebaut.
http://www.youtube.com/watch?v=_oRQh-cqJmQ
http://www.youtube.com/watch?v=-j9xtEFoydI
http://www.youtube.com/watch?v=5Up3ikwsY0I20. Nick Cave and the Bad Seeds – Tender Prey
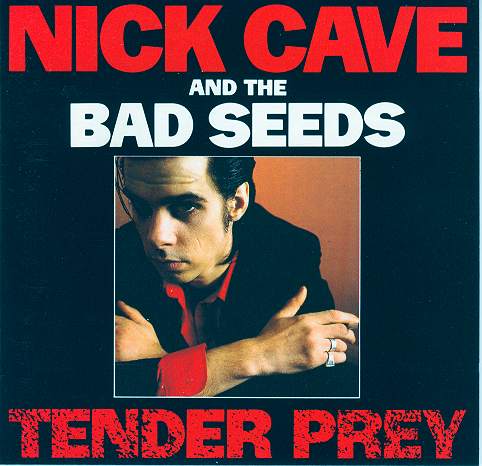
Best-Ofs sind ja…nun…immer so eine Sache. Bin ich, diplomatisch ausgedrückt, kein großer Fan von. Reißen die Songs unnötig aus dem Zusammenhang, Auswahl meist nicht zufriedenstellend, etc. pp. Welche Veröffentlichung von Nick Cave and the Bad Seeds, einer der besten Bands der letzten 20 Jahre, legt man aber denn nun jemand völlig Unbefangenem ans Herz? Die Antwort lautet „Tender Prey“. Und wieso denn nun?
Erstens, weil „Tender Prey“ alle Qualitäten mitbringt, die eine gute Best-Of haben sollte. Das wäre zum einen eine große stilistische Bandbreite, die möglichst viele Entwicklungsstufen der Band abdeckt und einen guten Überblick verschafft.
„Tender Prey“ wurde 1988 als eine Art Brückenschlagsalbum zwischen den roheren, sperrigeren ersten 4 Werken und den melodischeren, gradlinigeren Alben der 90er veröffentlicht. Auf dem Album steht dunkel-Abgründiges wie „Sunday’s Slave“ und „Mercy“ mit seinen unheilvoll grollenden Klavierläufen neben Stücken wie dem extrem tanzbaren „Deanna“ und dem versoffenen, doch optimistischen „New Morning“, das einen herrlichen Abschluss für „Tender Prey“ bildet (wenn man den Video Mix von „The Mercy Seat“ ignoriert *flöt*). Hier finden melancholische, entspannte Singer/Songwrtíter-Balladen wie „Watching Alice“ und „Slowly Goes The Night“ ebenso Platz wie abgrundtief Zynisches und Zähneknirschendes wie „Up Jumped The Devil“ und wüst rockende, an die Anfangstage erinnernde Songs wie „Sugar Sugar Sugar“, „City of Refuge“ und „The Mercy Seat“.
Zum anderen wären das ein möglichst hoher songwriterischer Standard und eine gewisse „Hitdichte“.
Nick Cave and the Bad Seeds haben in ihrer Karriere durchaus nicht wenige brillante Songs geschrieben (auch wieder so ein Grund, weshalb eine Best-Of einer solchen Formation nicht gerecht wird *hust*), einige der strahlendsten davon versammeln sich auf „Tender Prey“. Das wäre nebst insbesondere „Up Jumped The Devil“, „Mercy“, „City of Refuge“ sowie „Sugar Sugar Sugar“ gewiss der Opener „The Mercy Seat“. Manische Drums überrennen sich selber, ein lärmend wirbelndes Inferno aus Streichern reißt den Hörer mit sich, und der Text um einen zu Tode Verurteilten, der auf den elektrischen „Gnadestuhl“ wartet, ist einer der eindringlichsten und besten aus Caves Feder. Ich dürfte wohl zu den gar nicht mal so vielen Personen gehören, die das Original der Coverversion von Johnny Cash vorziehen.Zweitens aber auch, weil „Tender Prey“ das hat, was selbst der bestmöglichen Best Of abgeht: Kontinuität, eine Art Zusammengehörigkeit der Stücke, sodass das Album trotz seines Facettenreichtums wie aus einem Guss wirkt.
Ach ja: 1998 haben Nick Cave and the Bad Seeds eine Best Of veröffentlicht. Auswahl okay, aber wenn, dann kauft euch halt trotzdem lieber „Tender Prey“. :haha:
http://www.youtube.com/watch?v=WFdUTM4gU-o
http://www.youtube.com/watch?v=3J3QHzbK9jY
http://www.youtube.com/watch?v=cHLiLLOI7Dc
http://www.youtube.com/watch?v=sQM8G2ZjPrw19. Swans – Cop
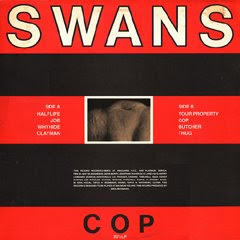
1982 gründete sich im New Yorker No Wave-Underground eine Band, die noch tiefe, bis heute nicht verheilte Wunden in den verschiedenartigsten Musikstilen hinterlassen sollte. Die Rede ist hierbei von Swans, Innovatoren und Weltenbummler. Zu Anfang der Bandlaufbahn stand der Name noch für einen rhythmisch geprägten, sperrig-monotonen, repetitiven, lärmigen Sound, was sich 1983 im offiziellen Albumdebüt manifestierte – es klang roh, rostig, filthy. Verstümmelte Rockmusik, ein Kotzbrocken von dem Herrn. Doch offenbarten Swans damit noch nicht ihr wahres Potenzial, dies sollte erst ein Jahr später mit dem Nachfolger „Cop“ geschehen. Es baute zwar auf dem von „Filth“ gebildeten Fundament auf, war jedoch in jederlei Hinsicht wesentlich konsequenter und drastischer.
Das Drumming wurde monolithischer, statischer und dröhnender. Das Tempo hatte man fast bis zum schockgefrosteten Stillstand gedrosselt, in den Songs war keine nennenswerte Bewegung, jegliche Dynamik wurde von vornherein vermieden. Der Gitarrensound war von einer Schwere und Brutalität, wie man sie Mitte der 80er noch nicht erlebt hatte. Frühe Swans waren somit durchaus auch ein wichtiger Wegbereiter für Doom Metal, vor allem für seine extremen Spielarten. Im Gegensatz zu Black Sabbath und Epigonen näherte man sich diesem Sound aber ohne Melodieseligkeit, ohne psychedelische Ansätze, die die Musik unnötig bunt gestalten könnten, und ohne den daran gekoppelten verklärten Romantizismus, der selbst dieser Teufelssymbolik auf dem Black Sabbath-Debüt noch irgendwie inne lag, sondern von der nüchternen, atonalen Ebene des Industrial aus. Konventionelle Songstrukturen suchte man vergebens, die Stücke glichen sich wiederholenden Leidenszeremonien. Michael Giras Texte thematisierten moderne Sklaverei, Heroinabhängigkeit, Vergewaltigung, die Abstumpfung und Isolation des Menschen und Gewalt, diesmal verstärkt mit dem Begriff der Polizei verkoppelt, aufs Grausamste, Gnadenloseste, Abgründigste und vor allem Reduzierteste. An seiner Sprache gab es nichts, was als auch nur der leiseste Anflug von Hoffnung oder Schönheit fehlinterpretiert werden könnte. Der Gesang Giras klingt so derartig angewidert, ist von einem solchen Nihilismus, von einer solchen Verachtung gegenüber der Welt, dem Menschen und dem Leben, wie ich es noch nie gehört habe. Ein Ausdruck jenseits von Trauer, Wut und Verzweiflung, dort singt/spricht eine Person, die bereits mit dem Leben abgeschlossen hat.
Nach einem halben Jahrzehnt sollten sich Godflesh auf ihrem legendären Debüt „Streetcleaner“ deutlich hörbar an diesem Meisterwerk orientieren, noch etwas später wurden frühe Swans eine der wichtigsten Inspirationsquellen für Sludge, doch konnte keine weitere Band die schiere Intensität von „Cop“ jemals erreichen.
Eine der in ihrer Wirkung und Ästhetik hässlichsten, bösartigsten, brutalsten und negativsten Platten, die jemals veröffentlicht wurden.http://www.youtube.com/watch?v=Y2uDE0x62aY
http://www.youtube.com/watch?v=I1JOf3QHvf4
http://www.youtube.com/watch?v=BDEEIA_7XR418. Swans – Soundtracks for the Blind

And wide are your delusions,
Deep red is the space behind your eyes,
Closed forever is the door to your room,
But inside there lives the sound,
You despise,
But I love…Mother, I was wrong.
I am wrong.Wenn es sich eine Band auf die Fahnen schreiben konnte, innovativ, künstlerisch rücksichtslos und im Wortsinne progressiv gewesen zu sein, so waren es definitiv Swans. Ihre Frühwerke werfen in ihrer beispiellosen Negativität noch immer auf alles, was unter dem Banner Black/Doom Metal/Sludge/whatever firmiert, einen langen Schatten. Konzerte, bei denen sich angeblich Besucher aufgrund der bloßen Lautstärke übergeben mussten, nährten den Mythos. „Children of God“ markierte den Wendepunkt; Songs wie „In My Garden“ oder das Titelstück wären in der Konsequenz auf keinem Frühwerk möglich gewesen. „White Light From The Mouth of Infinity“ ließ mit seiner musikalischen Ausrichtung zwischen Folk und Gitarrenwänden nahe einer Urform des Post Rocks oberflächlich keinen Rückschluss darauf, wofür die Band früher stand, und bot doch einige der besten Songs der gesamten Karriere der Schwäne. Nach dem Live-Album „Omniscence“ sollten Swans drei Jahre pausieren – das als großes Comeback inszenierte „The Great Annihilator“ war ein erster ernsthafter Bruch mit der Entwicklung. Es orientierte sich nicht eindeutig an bestimmten Vorgängerwerken und bot doch nichts grundsätzlich Neues, es hatte zweifelsfrei tolle Stücke wie beispielsweise „She Lives!“, Mind/Body/Light/Sound“, „Killing for Company“ und „Where Does A Body End?“ und konnte doch nicht an die Atmosphäre eines ähnlich songorientierten Werks wie „White Light From The Mouth of Infinity“ heranreichen. Es war bei weitem nicht schlecht, eigentlich sogar sehr gut (im Übrigen auch bestens als Einstiegsalbum geeignet und besser als „The Burning World“), mit einer Diskographie von diesem Format im Rücken aber zumindest für mich eine Enttäuschung. Dass der kreative Spirit so langsam schwand, war nicht zu verheimlichen. Tatsächlich sollten Swans sich 1997 auflösen, direkt post mortem kam das Live-Tondokument „Swans Are Dead“ auf den Markt.
Den Schwanengesang einer der bis heute einflussreichsten und wichtigsten Bands aus dem Umfeld des New Yorker No Wave bildete das 1996 veröffentlichte Monumentalwerk „Soundtracks For The Blind“. 141:38 Minuten Musik. Musik, die das völlige Gegenteil dessen darstellt, was „The Great Annihilator“ noch dominierte und was ich an diesem Album noch kritisiert habe und die darüberhinaus ohne Übertreibung nichts mehr mit irgendeinem der früheren Alben zu tun hat; dabei hört man jedoch immer noch, dass es sich um die selbe Band handelt. Musik, die die Existenz von Grenzen nicht nur infrage stellt, sondern sie schlichtweg ignoriert, als hätte es sie nie gegeben. Musik, die John Cages Spruch „Everything we do is music“ für mich erst erfahrbar gemacht hat. Musik, die in ihrer radikal experimentellen Ästhetik in gewisser Weise vielleicht sogar brutaler wirkt als die von trister Monotonie geprägten Frühwerke der Swans. Musik, die entweder totales Unverständnis oder aber ein in Schutt und Asche liegendes musikalisches Weltbild hinterlassen kann; so auch bei mir. „Soundtracks For The Blind“ war mein erstes Album der Swans (aus heutiger Sicht eine grandios dämliche Entscheidung, kein anderes Album ist als Einstieg ungeeigneter), nachdem ich mich vorher bereits flüchtig mit der Band vertraut gemacht hatte (unter den gehörten Einzelsongs befand sich auch „The Sound“ – klar, welches Album als erstes ins Haus musste…).
So erfolgreich sich Swans gängigen musikalischen Schubladen in der Vergangenheit widersetzten, angesichts kaum eines anderen Albums wirkten eigentlich recht offene Stilbezeichnungen wie Ambient, Industrial, Noise, Experimental/Post Rock so unzutreffend und lächerlich dogmatisch. Die meisten wirr und unzusammenhängend erscheinenden Geräuschkulissen sammeln sich auf der „Silver Disc“; Samples, Soundcollagen, angedeutete Melodien, Drones und Geräusche, die so etwas wie eine Struktur nicht einmal simulieren, das anfangs von Giras lakonisch-melancholischem Gesang dominierte „Animus“ verläuft zum Ende hin auch im musikalischen Nirwana. Die beiden von Jarboe gesungenen Stücke „Yum-Yab Killers“ und „Volcano“ finde ich bis heute regelrecht unhörbar. Everyone knows that you are fucked up and everyone knows that I am fucked up, but does everyone know that you are more fucked up than me?
Die „Copper Disc“ zeigt sich geringfügig konventioneller, und doch; das von Jarboe intonierte, wahnsinnig angsteinflößende „YRP“ und die vertonte Selbstgeißelung „The Final Sacrifice“ gehören zu den zugänglichsten, auch losgelöst vom Kontext noch am besten funktionierenden Stücken, weil sie in dieser zerrütteten Kulisse, zwischen Trümmern und Fragmenten zumindest etwas darstellen, woran man sich festhalten kann. „Soundtacks For The Blind“ lebt auch von seiner einzigartigen Atmosphäre: auf keinem Vorgängeralbum klangen die Swans derart surreal, verstörend und weltabgewandt, dabei aber nicht einmal immer ausdrücklich negativ. SFTB ist erfüllt von Leere, Isolation, Psychosen und Sadismus, es findet statt zwischen glatten weißen Kachelwänden und grellem künstlichen Licht. Und doch bildet genau diese Atmosphäre den Nährboden für unbeschreiblich schöne Momente, einige der besten Stücke der Swans, die in der Form auf keinem anderen Album Platz gefunden hätten. „Helpless Child“, das 15-minütige Herzstück der „Silver Disc“, wird erst von trägen Akkorden der akustischen Gitarre und Michael Giras lakonischer Stimme geprägt, verliert sich dann in ambientaler Leere, aus der eine so schlichte wie weit ausholende und epische, so traurige wie schöne Melodie entwächst, eine Melodie, die gerade im Kontext von „Soundtracks For The Blind“ besonders strahlend und rein und wahnsinnig intensiv wirkt. „The Sound“ hat damals vor einigen Jahren mein damals eh nicht mehr wirklich intaktes (Converge, Tool, Neurosis etc. waren schon…) Weltbild in Schutt und Asche und mich selbst völlig ungläubig und paralysiert hinterlassen. Nachdem Gira das letzte Mal, begleitet von einer in dem Kontext unglaublich melancholischen Melodie, „but I love“ gehaucht hat, steigert sich das Stück immer mehr in ein instrumentales Delirium. Die Gitarren und Drums vereinen sich zu einem berauschenden Chaos, „The Sound“ (war ein Songtitel jemals passender?) wirkt wie ein Wolkenkratzer, dessen Spitze selbst dann noch nicht erreicht ist, wenn die menschliche Wahrnehmung längst an ihre Barrieren gestoßen ist. Alle Farben dieser Welt, unheimlich schnell wirbelnd, vereinen sich zu einem vibrierenden Grau. „I am wrong“ lässt Gira ein letztes Mal verlauten, die von den Soundschichten begrabene Melodie hat sich wieder ihren Weg gebahnt und verläuft darauf hin in Glockenklimpern. Es wird ja öfters danach gefragt, welchen Song man bei seiner Beerdigung hören möchte – nun, ich möchte „The Sound“ unmittelbar vor meinem Tod hören.
„Soundtracks for the Blind“ ist somit ein absolut würdiger Abschluss – und sogar mehr als das. Das Album reiht sich problemlos in die Reihe der großen Klassiker der Band ein und kann den Legendenstatus der Swans sogar noch ausbauen. Einen eindrucksvolleren Schwanengesang hätte es in diesem Falle nicht geben können.
http://www.youtube.com/watch?v=gFFEgAsb9_0
http://www.youtube.com/watch?v=0oSD4VAfY1U
http://www.youtube.com/watch?v=WaPlRKB251c (ja, nicht so tolle Quali, aber eine Intensität, die die der formidabled Albumversion sogar noch übersteigt)
http://www.youtube.com/watch?v=myNF72pKmyM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=_86ecCxAYEI (der zweitbeste Song aller Zeiten)
http://www.youtube.com/watch?v=1MaPvJwr7Tc17. Alice In Chains – Dirt

Die 90er markieren in der Hartwurst-Szene in vielerlei Hinsicht sowas wie einen Umbruch. Kaum hatten sich gewisse Traditionen herausgebildet und etabliert, kamen zahlreiche neue Strömungen und Weiterführungen früherer Tendenzen auf. Grunge sollte dabei auch jenseits des Metal-Umfelds am populärsten werden, aber auch zum liebsten Prügelknaben der Metalheads. Wie war das noch mal…so Mitte der 90er ist der Metal doch gestorben, oder? Hahaha.
1992, auf dem kommerziellen Höhepunkt eben dieses Grunge-Hypes, veröffentlichten Alice in Chains ihr Meisterwerk. Bemerkenswert ist hier vor allem das (nie wirklich technisch konzentrierte/ausgefallene) Zusammenspiel der Musiker und das Songwriting, dessen auf „Dirt“ vorgeführte Brillanz die Band sowohl auf früheren als auch auf späteren Veröffentlichungen lediglich streifte. Alice in Chains schreiben im gewissen Sinne sowas wie „Hits“ – jedoch keinesfalls Songs fürs Formatradio. Stücke wie das hypnotische „Rain When I Die“, die zähneknirschend fiesen „Hate to Feel“ und „Angry Chair“ (wahnsinnig bedrohliche Strophen!) sowie das zwischen Verzweiflung und Paranoia und drogenbenebelter Benommenheit wechselnde „Sickman“ (Nomen est Omen!) werden trotz ihrer Eingängigkeit diesem Anspruch nicht gerecht, bzw. sie gehen weit darüber hinaus. Auch „Would?“, welches der Band (und der Seattle-Szene im Allgemeinen) im Zusammenhang mit dem Film „Singles“ zum endgültigen Durchbruch verhalf, hatte doch ein beachtenswert hohes Maß an Tiefe zu bieten. Eine Klasse, die die im Zuge des Post-Grunge bekannt gewordenen Nickelback und Konsorten nie erreichen werden.
Zu den Markenzeichen von Alice in Chains gehört vor allem auch der zweistimmige Gesang – selten harmonierten zwei Sänger so gut wie die von Layne Stanley und Jerry Cantrell. Stanley gehört wohl zweifelsfrei zu den besten, charismatischsten und markantesten Stimmen der 90er, keiner leidet so wie er. Anders als bei vielen anderen, eher Punk- und Psychedelic Rock-orientierten Vertretern der Seattler Szene, mehr noch als bei Soundgarden, spielte bei Alice in Chains schwerer, doomiger Metal eine wichtige Rolle, was sich besonders im Opener niederschlägt. „Them Bones“ öffnet die Tür zu „Dirt“, oder besser gesagt, tritt sie mit einer ungeheuren Wucht ein. Gerade die Produktion trägt daran einen hohen Anteil – höchstens eine Band konnte zu der Zeit mit einem ähnlich knochentrockenen, fetten, niederreißenden, geradezu apokalyptischen Sound aufwarten (kommen wir später noch zu). Besser und effektiver könnte die Gitarrenarbeit mit ihren zahlreichen WahWah-Effekten, aber auch die Atmosphäre nicht akzentuiert werden.
Wenn es einen Begriff gibt, der die Stimmung von „Dirt“ wirklich einzufangen vermag, so ist es „Wüste“. Brütend heiße Sonne, rissiger, vollkommen ausgetrockneter Boden, verstörende Wahnvorstellungen und Fata Morganas, die Aasgeier kreisen um den eigenen schweren Kopf und freuen sich auf ihr Fressen. Schaut euch halt einfach das Cover an und ihr wisst, was ich meine. Und wenn es einen Song gibt, der die Essenz von „Dirt“ einigermaßen wiedergeben kann, so ist es der Titeltrack. Zäh und schwerfällig quillen diese Melodien für die Ewigkeit aus den Boxen, Layne Stanleys Gesangslinien sind herrlich langgezogen. One who doesn’t care is one who shouldn’t be, I’ve tried to hide myself from what is wrong for me. Purer Nihilismus, pure Düsternis, pure Magie, anders kann man es nicht ausdrücken. Eben dieses Negative, immer am schmalen Grat zwischen Genie und Wahnsinn tänzelnde, dieser omnipräsente Hauch von Morbidität verleiht „Dirt“ seine unvergleichliche Aura – so schwer dies aufgrund des realen Bezugs auch im Magen liegen mag. Stanleys sehr krass und direkt beschriebene Drogensucht bildet das zentrale Thema von „Dirt“, doch auch die von Jerry Cantrell geschriebenen Songs fügten sich in ihrem Grundtenor in das thematische „Konzept“ ein. „Rooster“ bildet da die Ausnahme von der lyrischen Selbstzerstörung, Abgründigkeit und Egozentrik – ein Song von Cantrell über dessen als Veteran im Vietnamkrieg gefallenen Vater.
Das jederzeit überragende songwriterische Niveau ist das, was Alice in Chains ausmacht, weswegen ich mich trotz des tragischen drogenbedingten Ablebens von Layne Stanley (R.I.P.) „Black Gives Way To Blue“ durchaus mag. Doch erst das ganz spezielle Flair macht „Dirt“ zu dem, was es ist – eines der großartigsten Alben der 90er und eines der vollkommensten Rockalben aller Zeiten.
http://www.youtube.com/watch?v=gl2EOlhwnIM
http://www.youtube.com/watch?v=j717wuo1snk
http://www.youtube.com/watch?v=8AJT8PCzZFY
http://www.youtube.com/watch?v=Rs6RefV1td4--
trying to leave [COLOR=#808080]a mark more permanent than myself[/COLOR]palez
Eine gute Gelegenheit, mal ein paar Wissenslücken zu schließen, oder? 😉
Außerdem kommt gewiss noch mindestens ein Album, das du kennst…:-XIch werd mich einen Tag bestimmt mal druchhören 😉
Momentan ha ich aber schon soviele Sachen die unbedingt mal gehört werden müssen.
z.B. deverses von Boris, OM….Hmm. ich bin gespannt welche Platte du meinst ^^
Aenima von Tool nehm ich an. 😉
Hui, waren Alice In Chains nicht letztes mal sogar Platz 2 oder 3? Da muss dann ja noch einiges kommen!
Ab jetzt nur noch ein Album pro Tag.
16. Fields of the Nephilim – Elizium

Tell me…what is reality?
Na, Kinder, alle schön die Nebelmaschinen angeschmissen, die Familienpackung Mehl rausgeholt und den ranzigen Cowboyhut aufgesetzt? „Hä, nein, wovon redet dieser Schwachkopf da überhaupt?“ So oder so ähnlich trat die britische Gothic Rock-Formation Fields of the Nephilim Mitte der 80er in Erscheinung. Gewiss lag es am anfangs noch recht konventionsgebundenen Sound, doch vor allem auch an eben diesem Auftreten, dass die Band anfangs noch als The Sisters of Mercy-Klon gebrandmarkt wurde, doch man konnte sich recht schnell davon emanzipieren. War die Western-Ästhetik bei den Sisters noch dem Faible für komische Hüte vom damaligen Gitarristen Wayne Hussey (The Mission) geschuldet, so gingen die Fields das Ganze wesentlich tiefgreifender, ambitionierter, irgendwie ernster, regelrecht konzeptuell an – im Auftreten, audio-visueller Ästhetik und den Texten vermischte Bandkopf Carl McCoy Spaghetti-Western mit postnuklearem Endzeitszenario, Lovecraft mit Crowley, Schamanismus mit Chaosmagie und der Nephilim-Legende. Und während der Trend damals eher Richtung Drumcomputer ging, setzte man bei Fields of the Nephilim eher auf einen natürlichen, erdigen Sound, der die Band als eine der ersten (jaja, The Cult…andere Geschichte) in die Nähe von Hard Rock rückte.
Von Kritikern gelobt und mit einer großen Fanbase im Rücken avancierte Fields oft he Nephilim Ende der 80er somit zu den wohl wichtigsten und einflussreichsten Protagonisten des Gothic Rocks der zweiten Welle – doch die konventionellen Songstrukturen wurden McCoy allmählich zu plump und einengend, konnten sie die erzielte Atmosphäre doch kaum wirklich tragen. Was auf den ersten beiden Werken nur angedeutet wurde, kommt hier in einer bis dato ungeahnten Konsequenz zu tragen; wer mit der Erwartung an „Elizium“ herangeht, einen eingängigen, klar strukturierten Hit der Marke „Moonchild“, „Power“ oder „Preacher Man“ vorzufinden, wird gnadenlos enttäuscht. Die Single „For Her Light“ tendiert vielleicht in diese Richtung, bleibt als einzelner Song erschreckend weit hinter den Qualitäten genannter Vorzeigehits zurück – anscheinend durchaus gewollt. Das Stück verschmilzt mit den anderen sieben zu einer untrennbaren Einheit und bildet so etwas wie das bloße Preludium zu „At The Gates of Silent Memory“; es scheint, wie vieles auf dem Album, oberflächlich recht unbewegt und vermittelt doch eine solch sinistere, bedrohliche Stimmung, wie es den Fields in der Form bis dato nie gelungen ist. Der beispiellos intensive Spannungsbogen des Drummings mündet vor seiner finalen Auflösung in das ungewöhnlich kurze, schnelle und rockige „(Paradise Regained)“, doch das soll auch der letzte Akzent dieser Art sein.
Die Stücke gehen nahtlos in einander über und funktionieren eigentlich gar nicht außerhalb ihres Kontexts. Die unwirklichen, sphärischen, somnambulen Melodien der Gitarren, das Drumming, mal viel zu weit im Hintergrund und mal viel zu aufdringlich und dominierend wirbelnd, um wirklich Halt zu bieten, der Grabesgesang des Berufsirren Carl McCoy und die so ziel- wie endlosen, sich ausweitenden Kompositionen verlaufen aquarellartig; unheimlich viele Variationen und Mischungen dunkler Farben, aber keine wirklich klar erkennbaren Muster. Die Songs kennen keine klaren Strukturen und keinen kalkulierten Aufbau, sie entfalten sich entweder in weiter, endloser Monotonie oder in sich langsam entwickelnder Psychedelik. Apropos, gutes Stichwort: „Elizium“ mutet allgemein höchst psychedelisch an, nicht selten denkt man an eine frisch dem Grab entstiegene Version von Pink Floyd ohne irdischen Bezug und ohne wirklich greifbaren, menschlichen Optimismus. Durchaus kein Zufall, „Elizium“ wurde zusammen mit dem Pink Floyd-Live-Keyboarder aufgenommen und von Andy Jackson wirkungsvoll großflächig produziert. Im entspannten Schwelgen von „Wail of Sumer“/“And There Will Your Heart Be Also“ findet „Elizium“ einen wunderbar einlullenden und idyllischen Abschluss.
Mit „Elizium“ haben Fields of the Nephilim 1990 ihren hohen Status endgültig zementiert. Man vertonte eindrucksvoll die zuvor bemühte Atmosphäre, indem man frühere Trademarks über Bord warf und die selbstauferlegten Barrieren durchbrach, „Elizium“ steht in einem großen Abstand zum damals bereits stagnierenden Gothic Rock und ist in seiner bis heute unerreichten Stimmung doch so etwas wie sein Idealbild. Nach dem (grandiosen; teilweise wird die Intensität der Studio-Versionen sogar noch überboten) Live-Album „Earth Inferno“ von 1991 trennte sich McCoy von der Band und machte mit seinem wesentlich metallischer ausgerichteten Projekt The Nefilim weiter, der Rest der Band gründete Rubicon. Die (vorläufige) Trennung der Fields of the Nephilim mutete wie der finale symbolische Abschluss mit dem Gothic Rock nach traditionellem Verständnis an. Nichtsdestotrotz wurde 15 Jahre nach „Elizium“ „Mourning Sun“, das vierte offizielle Studioalbum der Fields, veröffentlicht, mit Carl McCoy als einziges Originalmitglied (die Originalmitglieder waren zuvor eh kaum bzw. gar nicht am Songwriting beteiligt, insofern…). Das Album klingt modern, ohne die Wurzeln der Band zu leugnen, und kann dem britischen Patienten (als eines der meiner Meinung nach erschreckend wenigen Alben nach der Jahrtausendwende) kurzzeitig wieder so etwas wie Leben einhauchen. Ach ja, die komische, unausgegorene, ohne Einverständnis der Band veröffentlichte Demo-Sammlung „Fallen“ von 2002 wurde mal dezent totgeschwiegen…
Für mich ist „Elizium“ die Krönung des Schaffens von Fields of the Nephilim. Wenn überhaupt, hätte das Album einzig die Inklusion des brillanten, zuvor als Maxi veröffentlichten „Psychonaut Lib III“ aufwerten können.
--
trying to leave [COLOR=#808080]a mark more permanent than myself[/COLOR]Abgesehen davon das du das Layout zerfickt hast, nette Liste soweit. Die Neubauten und Swans würden bei mir wohl auch definitiv in der Liste landen.
MolochAbgesehen davon das du das Layout zerfickt hast, nette Liste soweit. Die Neubauten und Swans würden bei mir wohl auch definitiv in der Liste landen.
Ach du Scheiße…

*mal ein paar Hörbeispiele wegmach und auf Rückzerfickung hoff*
--
trying to leave [COLOR=#808080]a mark more permanent than myself[/COLOR] -
Du musst angemeldet sein, um auf dieses Thema antworten zu können.